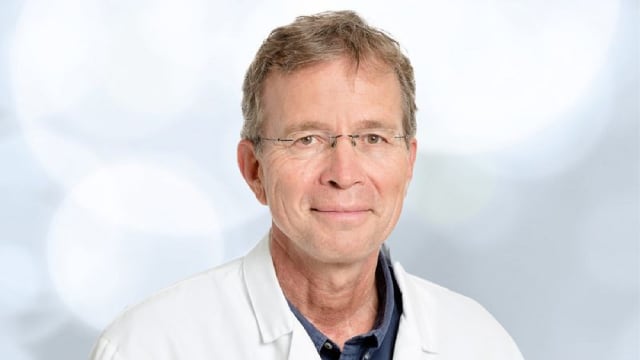Frau Gurtner, vor zwei Jahren sagten Sie in einem Interview, für 8,5 Millionen Einwohner bräuchte die Schweiz 850 Spitalbetten für spezialisierte Palliative Care. Wir hatten aber bloss 375. Was hat sich seither getan? Wir sind nicht viel weiter als vor zwei Jahren. Wir haben heute 390 zertifizierte Palliativbetten. Doch die Tendenz der Ambulantisierung, also die Verlagerung weg von stationären hin zu mehr ambulanten Behandlungen, betrifft auch die Palliative Care. Wir brauchen heute keine 850 zertifizierte Palliativbetten. Es braucht eine gute ambulante palliativmedizinische Begleitung und parallel dazu braucht es mehr Betten in Hospizen.
Ist denn die Schweiz in der ambulanten Palliative Care genug gut aufgestellt?
Nein, da gibt es noch einiges zu tun. Wenn Palliativpatientinnen schneller wieder heimgehen oder allenfalls in eine Langzeitinstitution oder sogar in eine Reha gehen, so muss die Palliativmedizin mitziehen.
Was heisst das konkret? Dass die Spitex Palliative-Mediziner unter Vertrag nehmen muss?
Die Spitex muss spezialisierte Teams bilden. Viele Spitex-Organisationen haben das bereits gemacht, zum Teil mit medizinischen Fachpersonen, zum Teil ohne. Diese Teams arbeiten dann mit Zentrumsärzten oder mit spezialisierten Hausärztinnen und Hausärzten zusammen.
Renate Gurtner übergibt an Corina Wirth
Nach fünfeinhalb Jahren als Geschäftsführerin der Fachgesellschaft Palliative.ch ging Renate Gurtner Vontobel Ende Januar 2025 in Pension. Ihre Nachfolgerin ist Corina Wirth: Die studierte Physikerin hat in Neurophysiologie promoviert, bis Ende 2024 war sie Geschäftsführerin des nationalen Fachverbandes Public Health Schweiz.
Sie sagen, es gäbe bereits solche Spezialistenteams. Wo stehen wir hier?
Wie immer in der Schweiz ist das von Kanton zu Kanton verschieden. Die Romandie ist breiter und besser aufgestellt als die Deutschschweiz. Sie hat auch eine längere Tradition. Gut aufgestellt ist auch Zürich. Bern hat jetzt aufgestockt. Auch Basel hat ein Team. Solothurn beispielsweise hat in dieser Beziehung noch wenig gemacht. Insgesamt passiert jetzt sehr viel in dieser Richtung.
Und wer bezahlt das alles?
Das wollte ich gerade sagen. Es steht und fällt mit der Finanzierung. Die Leistungen sind nicht finanziert. Wir sprechen hier von so genannten Beratungsleistungen, die in der zweiten Linie passieren. Sie beraten die Pflegefachkräfte der Spitex oder die Hausärztinnen, die selber tarifarisch abrechnen. Doch für diese Zweitlinienleistungen - es ist wie mit dem Back-office - gibts bis heute noch keine Tarife.
Apropos Finanzierung: Die ehemalige SP-Ständerätin Marina Carobbio reichte im Herbst 2020 eine Motion ein «für eine angemessene Finanzierung der Palliative Care». Beide Räte stimmten ihr zu. Seither habe ich nichts mehr gehört. Die Motion Carobbio wurde im Sommer 2021 dem Bundesrat in Auftrag gegeben. Die Umsetzung ist in der Verantwortung des Bundesamts für Gesundheit (BAG), das weitere Studien in Auftrag gegeben hat, um Variantendiskussionen führen zu können. Gemäss meinem Wissensstand soll der Bericht mit Finanzierungsvarianten im Sommer 2025 dem Bundesrat unterbreitet werden.
Ist der Bundesrat überhaupt der richtige Adressat? Finanzierung und Tarifierung ist Sache der Kantone beziehungsweise der Tarifpartner.
Es braucht eine nationale Regelung. Das gilt für stationäre Einrichtungen, für mobile Palliativteams wie auch für Hospize. Bei den Hospizen muss geklärt werden, wie deren Leistungen gemäss KVG entschädigt werden. Heute werden sie gehandhabt wie ein Pflegeheim. Das ist nicht richtig und auch nicht kostendeckend.
Jüngst erst stimmte die nationalrätliche Gesundheitskommission einer parlamentarischen Initiative zu, die ebenfalls die Finanzierung der Palliative Care geregelt haben will. Verlangt sie nicht das Gleiche wie die Motion? Für die 51 Nationalrätinnen und Nationalräte über alle Parteien hinweg, die die Initiative unterschrieben haben, geht es nicht schnell genug. Seit vier Jahren warten wir auf die Umsetzung der Motion Carobbio. Es braucht jetzt einen Ruck. Die Initiative verlangt eine bessere Finanzierung der Langzeitbegleitung, der geriatrischen Palliative Care. Sie nimmt auch die Finanzierung der Hospize auf. Und sie sagt, die Palliative Care muss im KVG besser abgebildet werden.
Also in etwa das Gleiche, was schon die Motion Carobbio verlangt.
Ja, es geht darum, Dampf aufzusetzen. Wenn die Bundesbehörde nicht reagiert, so muss halt das Parlament das Heft in die Hand nehmen.
Ist die parlamentarische Initiative dazu wirklich ein geeignetes Mittel? Auch die Einführung einer einheitlichen Finanzierung (Efas) kam wegen einer parlamentarischen Initiative zustande. Vom Einreichen des Vorstosses bis zur Volksabstimmung vergingen 15 Jahre.
Wir verfolgen hier eine Art Guerilla-Taktik. Es geht darum, von mehreren Seiten Druck aufzulegen. Es ist höchste Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. So schwierig ist das nicht. Es braucht nicht ein neues Gesetz. Die Grundlagen sind vorhanden. Und es gibt vieles, das in der Kompetenz des Bundesrats abgehandelt werden könnte.
Sie nannten die Hospize. Hier haben wir keine gesetzliche Grundlage.
Das ist richtig. Das soll mit der parlamentarischen Initiative geändert werden. Darin steht wörtlich: «Klärung der Vergütung von Leistungen in Hospizen». Hier stellt sich die Frage, wieweit Hospize beispielsweise als Leistungserbringer im KVG aufgeführt werden. Das Grundproblem besteht darin, dass die Hospize in der Gesamtversorgung nicht berücksichtig wurden. Sie sind erst später hinzugekommen. So wie sich das Gesundheitswesen entwickelt, braucht es Hospize mit einer spezialisierten Palliativversorgung.
Ende Januar geben sie die Geschäftsführung nach fünfeinhalb Jahren ab. Ziehen wir Bilanz: Was bleibt Ihnen als negativer Aspekt in Erinnerung?
Die politische Arbeit und die ungelöste Frage der Finanzierung. Das verlangt einen langen Schnauf, viel Energie. Das lässt einen an den Fingernägeln kauen. Das macht einen ungeduldig. Es ist einfach schwer nachzuvollziehen, dass das so lange dauert.
Auf was blicken Sie mit Zufriedenheit zurück?
Das Positive überwiegt. Ich konnte in diesen fünfeinhalb Jahren erleben, dass das Image, das Wissen und die Bedeutung der Palliativmedizin gestiegen ist. Immer mehr Leute verstehen, was es mit Palliative Care auf sich hat. Sie hat auch eine grössere Akzeptanz in der Fachwelt. Nicht zuletzt auch dank der Corona-Pandemie, wo Diskussionen über Patientenverfügungen, übers Sterben und den Tod verstärkt geführt wurden.
Mit Sophie Pautex gewann im letzten Jahr eine Palliativmedizinerin den «Viktor» für die medizinische Meisterleistung des Jahres.
Das ist ein sehr gutes Beispiel. Auch in der Fachwelt geniesst Palliative Care eine höhere Wertschätzung. Wenn eine Palliative-Medizinerin den «Viktor» bekommt für die medizinische Meisterleistung des Jahres, dann ist das grandios. Das hat eine wunderbare Ausstrahlung für die gesamte Palliativmedizin, aber natürlich auch für Sophie Pautex. Sie hat das grösste Zentrum Palliative Care in der Schweiz aufgebaut. Sie macht grossartige integrierte Medizin. Sie ist als erste Palliativmedizinerin im HUG, dem Genfer Universitätsspital, zur Chefärztin aller Chefärzte gewählt worden. Und ebenfalls im HUG ist eine Palliative-Expertin mit Hintergrund Pflege Präsidentin vom Ethikrat geworden.