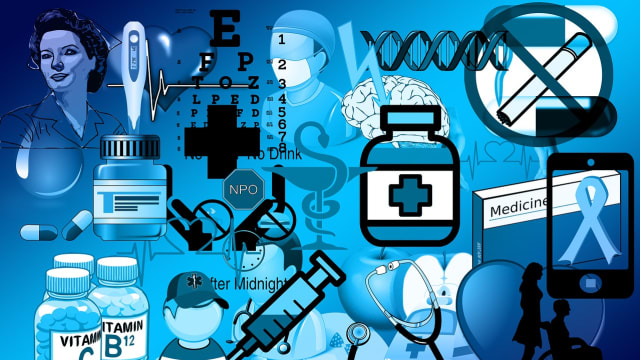Die Reform der Spitalfinanzierung im Jahr 2012 hat wichtige Ziele erreicht: Sie brachte mehr Wettbewerb und Effizienz, mehr Qualität und Transparenz. In Bezug auf die Eindämmung des Kostenwachstums ist die gewünschte Wirkung aber «weitgehend ausgeblieben». Dies stellt die Beratungsgesellschaft
PwC in ihrem neusten
Spitalbericht fest.
Grund für die höheren Kosten sind die steigenden Fallzahlen. Da die Preise im Gesundheitssektor etwa gleich geblieben sind, handelt es sich um ein Mengen- und nicht um ein Preiswachstum. Die Umsätze der Schweizer Spitäler nehmen jährlich zwischen drei und sechs Prozent zu.
Fehlanreize beseitigen
Ein Ende der Ausweitung ist nicht abzusehen. Neben nachvollziehbaren Gründen wie dem demographischen Wandel und dem medizinischen Fortschritt tragen laut PwC Fehlanreize zur Kostensteigerung bei. «Um die Begrenzung des Mengenwachstums zu erreichen, sind neue Ansätze zu prüfen», schreiben die Autoren und legen einen Massnahmenkatalog vor.
Medienmitteilung und Studie:
«Schweizer Spitäler: Innovative Ansätze und ein Umdenken sind gefragt» - PwC, Dezember 2016 Vorschläge zur Eindämmung des Kostenwachstums
- Mehr Wettbewerb: Verdeckte Subventionen durch die Kantone sollen abgebaut werden. Langfristig bieten Privatisierungen die Chance, den Wettbewerb zu erhöhen und damit den Druck zur Wirtschaftlichkeit auf die Spitäler zu erhöhen. Offen bleibt, ob dabei die versorgungspolitischen Ziele eingehalten werden können.
- Ausgeglichene Finanzierung ambulant / stationär: Unterschiedliche Finanzierungssysteme von ambulanten und stationären Behandlungen gehören laut PwC zu den grössten Fehlanreizen im Gesundheitswesen. Spitalkosten werden von Kantonen und Kassen bezahlt, ambulante Behandlungen nur von Kassen. Die Unterscheidung führt dazu, dass Krankenversicherer eine konsequente Verlagerung in den ambulanten Bereich ablehnen.
- Mehr Fairness zwischen Grund- und Zusatzversicherung: Die Behandlung für eine Erkrankung mit gleicher medizinischer Indikation soll unabhängig von der Versicherungsklasse des Patienten erfolgen.
- Weniger Interessenskonflikte: Kantone sind gleichzeitig Leistungseinkäufer, Tarifgenehmiger, Versorgungsplaner und teilweise Eigentümer von Spitälern, was zu Interessenskonflikten führt. Spitäler sollten darum aus den städtischen oder kantonalen Verwaltungen herausgelöst und in wirtschaftlich eigenständige Gesellschaften überführt werden.
- Mengenregulierung: Mit einer Vorsorgungsplanung in grösseren Versorgungsregionen kann die Mengenausweitung eingedämmt werden, wie etwa die Versorgungsregion Nordwestschweiz zeigt. Auch verbindliche Obergrenzen in Form von Globalbudgets dienen der Einschränkung der Mengenausweitung und haben sich in Kantonen wie Genf, Waadt oder Tessin bewährt.
- Mehr Eigenverantwortung der Patienten: Die Häufigkeit des Franchisewechsels könnte eingeschränkt werden, auch die Erhöhung der Mindestfranchise oder des Selbstbehalts sind Varianten. Denkbar ist auch eine Strafgebühr für Patienten, die in den Notfall gehen, ohne Notfallleistungen zu beziehen.
- Mehr Transparenz: Im Bereich der Gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) besteht wenig Transparenz zwischen den Kantonen. PwC fordert eine klare und schweizweit einheitliche Finanzierung der GWL. Auch in der Beratung zwischen Ärzten und Patienten ist mehr Transparenz gefragt, etwa im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit der Leistungen.
Siehe auch:
«Die Rentabilität der Schweizer Spitäler ist nochmals etwas gesunken»«Wie wir im Gesundheitswesen eine Milliarde Franken sparen könnten»