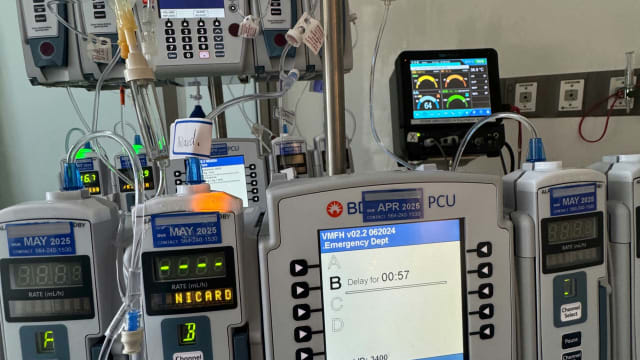Die Zahl der berufstätigen Ärzte in der Schweiz ist in den letzten zehn Jahren von 34'300 auf 42'600 gestiegen. Die FMH kommentiert ihre neuste Ärztestatistik von 2024 mit folgenden Worten: «Das sind 1502 Personen oder 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zunahme ist erfreulich, aber viel zu gering, um den Fachkräftemangel aufzufangen.»
Die Schweiz hat im europäischen Vergleich eine relativ hohe Ärztedichte. Pro 1000 Einwohner gibt es 4,74 Ärzte, was über dem EU-Durchschnitt liegt. Die Dichte nimmt auch von Jahr zu Jahr zu. Noch vor zehn Jahren sorgten nur 4,1 Ärzte für 1000 Einwohner.
Das Problem ist: Die Ärzte in der Schweiz sind sehr ungleich verteilt. In grossen Städten hat es viele Mediziner, und auch Spezialärzte und -ärztinnen gibt es oft genug.
Was fehlt, sind Hausärzte ausserhalb der Städte. In der Grundversorgung beträgt die Ärztedichte in der Schweiz im Durchschnitt nur 0,8. Die WHO und die OECD empfehlen eine volle Hausarztstelle pro 1000 Einwohner.
Die regionalen Unterschiede sind deutlich: In städtischen Gebieten wird der Zielwert von 1,0 erreicht, während er in ländlichen Gebieten mit 0,4 Ärzten pro 1000 Einwohner deutlich darunter liegt.
Mehr Teilzeitarbeit
Einzuräumen ist ausserdem, dass die Zahl der Ärzte nicht der Zahl der Vollzeitstellen entspricht. Immer mehr Ärztinnen und Ärzten möchten Teilzeit arbeiten – und tun dies in Gemeinschaftspraxen. An Bedeutung verliert das Modell von Einzelpraxen, welche oft von praktizierenden Ärzten mit sehr hohen Wochenarbeitszeiten geführt wurden, stellt die FMH in ihrer Statistik fest. 2014 waren 57,2 Prozent der Ärztinnen und Ärzte in Einzelpraxen tätig, heute sind es noch 39,6 Prozent.
Auch 60 Wochenarbeitsstunden und mehr, wie dies früher eher üblich war, sind seltener geworden. Das durchschnittliche Arbeitspensum sinkt stetig, wenn auch nur leicht. 2014 betrug das durchschnittliche Arbeitspensum 8,9 Halbtage. 2024 arbeiteten Ärztinnen und Ärzte im Schnitt 8,6 Halbtage pro Woche.
Andere warnen vor zu vielen Ärzten
Nicht alle Akteure im Gesundheitswesen sind aber wie die FMH der Meinung, dass es in der Schweiz zu wenig oder sogar viel zu wenig Ärzte und Ärztinnen gebe. So argumentiert das Bundesamt für Gesundheit (BAG), dass die Schweiz im europäischen Vergleich eine sehr hohe Ärztedichte habe und es – zumindest auf nationaler Ebene – keine akute Unterversorgung gebe.
Seit Juli 2023 sind die Kantone im Rahmen der kostendämpfenden Massnahmen in der Krankenversicherung sogar angehalten, Höchstzahlen für die ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte zu definieren. Die Kantone sehen zumindest in städtischen Gebieten keine Notwendigkeit für zusätzliche Ärzte.
Es gibt auch Ärzte, laut denen mehr aus ihrem Fach nicht automatisch bessere Gesundheitsversorgung bedeuten: Sie plädieren für mehr Qualität statt Quantität. So beispielsweise der Chirurg Othmar Schöb in einem
Interview mit Medinside: «Wir haben heute viermal mehr Mediziner als noch vor 30 Jahren und folglich viel höhere Kosten bei sinkender Qualität. In Zukunft müssten weniger Chirurgen ausgebildet werden: nur jene, die es wirklich braucht. Die Anzahl der Weiterbildungskandidaten ist heute zu hoch und nach zwei Jahren steigt ein Grossteil aus der Chirurgie aus. Dabei geht viel Ausbildungssubstanz für jene verloren, die wirklich geeignet sind für den Beruf. Ich plädiere deshalb für ein System, bei dem man im ersten Jahr den ‘Spreu vom Weizen’ trennt, sprich nur jene Leute weitermachen lässt, die wirklich geeignet sind. Diese sollten dann auch entsprechend gefördert werden.»
Auch Gesundheitsökonomen waren vor Überkapazitäten und steigenden Gesundheitskosten. Reine Personalerhöhungen würden wenig nützen. Es brauche Effizienz und neue Strukturen. Die Universität Luzern hat kürzlich sogar ein
Programm gestartet, das Gesundheitsfachleute für die Vermeidung von Überversorgung sensibilisieren soll.
- Für E-Learning- und Fortbildungs-Angebote für Ärzte und Apotheker: med-cases.