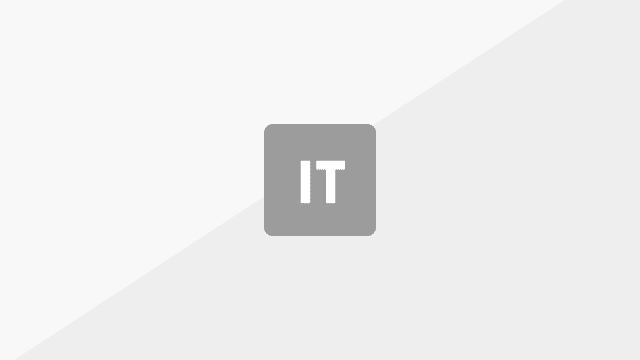Die Gesundheitsdirektoren-Konferenz GDK erarbeitet zurzeit neue Empfehlungen für die kantonalen Spitalplanungen und deren Koordination. Das ist bekanntlich eine heikle Sache: Die Kantone regulieren einerseits die Spitäler – andererseits betreiben sie selber Spitäler aller Art und Grössenklassen.
Und dass sie in diesem Interessenkonflikt nicht gerade objektiv sind – dafür gibt es allerhand Hinweise (siehe etwa
hierhierhier, hier und hier). Die Privatspitäler blicken also mit einer gewissen Sorge auf die geplanten neuen Empfehlungen, zumal die Debatte darüber hinter verschlossenen Türen stattfindet.
Warnung vor dem fait accompli
Und weiter: «Die Mehrfachrolle der Kantone im Gesundheitswesen muss einem transparenten Dialog weichen.»
Dazu hat PKS ein Positionspapier erarbeitet: Es hält 16 Anforderungen fest, welche – laut dem Verband – eine gesetzeskonforme GDK-Empfehlung zu erfüllen hätte. Und grundsätzlich sei es an der Zeit für ein offenes Vorgehen der GDK, denn: «Gemeinsam erarbeitete Richtlinien beugen im besten Fall künftigen gerichtlichen Streitigkeiten vor.»
«Strikt nach KVG»
Konkret sind neue Empfehlungen für die Privatspitäler nur akzeptabel, wenn sie strikt nach KVG erfolgen und folglich weder den Wettbewerb noch die freie Arzt- und Spitalwahl behindern; wenn sie keine Übergriffe in den Zusatzversicherungsbereich in sich tragen; wenn sie keine willkürlichen Massnahmen zur Strukturerhaltung bieten; und wenn die ärztliche Zuweisung in stationär beziehungsweise ambulant frei bleibt.
En detail lauten die 16 Forderungen der Privatspitäler:
1. KVG gilt: Die Spitalplanung erfolgt für alle Spitäler, die einen Listenplatz beantragen, gleich – nach objektiven und nicht diskriminierenden Kriterien der Wirtschaftlichkeit und der Qualität.
2. Transparenz: Die Kriterien müssen transparent sein. Die Planung erfolgt leistungsorientiert anhand von Fallzahlen und Pflegetagen. Mindestfallzahlen müssen qualitativ begründet sein, trägerunabhängig für alle Spitäler gelten und sollen den regionalen Kontext berücksichtigen.
3. Praktikable Planung. Die Planungskriterien müssen verhältnismässig und praktikabel sein. Ein landesweites Ausrollen von Planungskriterien, welche in urban-universitären Kantonen üblich sind, hätte laut PKS fatale Folgen für die Versorgungssicherheit in Randregionen.
4. Referenztarife. Tarife bei ausserkantonalen Behandlungen müssen auf einer schweizweit einheitlichen, transparenten, klar terminierten, nachvollziehbaren Regelung der Referenztarife fussen.
5. Keine Grundversicherten-Quoten. Jeder zusatzversicherte Patient ist auch ein grundversicherter Patient. Die Aufnahmepflicht ist auch dann erfüllt, wenn ein Listenspital eine grosse Zahl grundversicherter Patienten mit Zusatzversicherung behandelt.
6. Ambulant und stationär. Die Zuteilung von Eingriffen zum ambulanten oder stationären Bereich muss aufgrund einer medizinischen und nicht einer politischen Beurteilung geschehen. Ansonsten machen sich die Kantone für Komplikationen von ambulanten Eingriffen haftbar.
7. Investitionsfreiheit. Eine Bewilligung von Investitionen durch die öffentliche Hand ist nicht notwendig. Dies ist Sache der Spitalbetreiber.
8. Kein GAV-Zwang. Personalvorschriften wie die GAV-Unterstellung können nicht Gegenstand der Empfehlungen sein, da keinerlei Grundlage im KVG besteht.
9. KVG, nicht Versicherungsrecht. Die GDK-Richtlinien beziehen sich auf die Umsetzung der Spitalplanung des KVG. Die Kantone haben keine Kompetenz, in das VVG gesetzgeberisch einzugreifen.
10. Transparenz bei Subventionen. Leistungsaufträge und gemeinwirtschaftliche Leistungen sind transparent zu machen.
11. Transparenz bei Prozessen. Anschliessend an die Publikation sind die Leistungsaufträge und die gemeinwirtschaftlichen Leistungen ausnahmslos öffentlich auszuschreiben, so dass sich jeder Leistungserbringer bewerben kann.
12. Überprüfung der Leistungsaufträge. Die Vergabe der Leistungsaufträge und der gemeinwirtschaftlichen Leistunen ist regelmässig zu überprüfen. Ausserordentliche Überprüfungen haben nach klar definierten Kriterien periodisch zu erfolgen. Bei jeder Überprüfung haben wieder alle Leistungserbringer eine gleichberechtigte Chance.
13. Hochspezialisierte Medizin. HSM-Leistungen sind durch die Kantone nicht mehr zu planen. Alle Patienten können zum jeweiligen Standorttarif in eine Institution mit HSM-Leistungsauftrag gehen.
14. Ausserkantonale Leistungsaufträge. Die Vorgaben der Bundesverwaltungsgerichts-Urteile Susch und Aadorf dürfen von den Kantonen nicht dazu missbraucht werden, um ausserkantonalen Leistungsaufträge insbesondere von Privatkliniken zu verhindern.
15. Tarifgenehmigung. Im Bereich der Tarifgenehmigung sind nachprüfbare, für alle Kantone verbindliche Prinzipien zu entwickeln.
16. Wirtschaftlichkeitsprüfung. Bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung ist lediglich auf die Wirtschaftlichkeit einer Institution und nicht auf den Spitaltyp abzustellen.