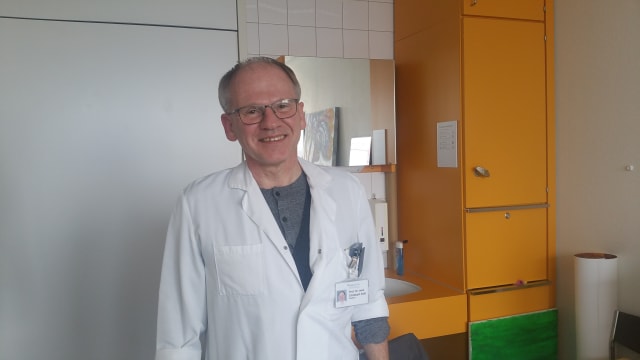Herr Aebi, Sie waren acht Jahre Direktor der Kinderklinik des Inselspitals in Bern. Warum haben Sie das Amt abgegeben?In den acht Jahren, in denen ich die Klinik führte, hat sich das Stellenprofil stark verändert. Und zwar von einem Direktor, der noch Einfluss hatte auf Patientenbetreuung, auf Inhalte der Forschung und auf Inhalte der Lehre hatte, zu einem CEO, der nur noch administrativ tätig war. Ich sehe mich vor allem als Arzt, als akademischer Forscher und weniger als Betriebswirtschafter. Für die restlichen zehn Jahre meiner beruflichen Tätigkeit wollte ich in mein angestammtes Gebiet zurückkehren.
Sind Sie froh, Teil des Berner Universitätsspitals zu sein, oder beneiden Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen, die in einem reinen Kinderspital in Basel, St. Gallen oder Zürich tätig sind?Beides hat Vor- und Nachteile. Wirtschaftlich ist es sicher von Vorteil, Teil einer grösseren Gruppe zu sein, um Redundanzen in der Technik und der Materialbeschaffung zu vermeiden.
Haben Sie Beispiele?Wir haben viele teure Geräte wie etwa MRI Geräte, die refinanziert werden müssen. Als Teil eines grossen Spitals können wir günstiger produzieren, die Geräte häufiger auswechseln und durch die neusten Modellen ersetzen, weil wir einen grösseren Turnover und ingesamt mehr Patienten haben.
Und der Vorteil reiner Kinderspitäler?Sie haben einen eigenen Verwaltungsrat oder Stiftungsrat, in dem womöglich auch noch ein Regierungsrat Einsitz nimmt. Sie können daher gezielter auf die besonderen Bedürfnisse eines Kinderspitals eingehen. In Zürich beispielsweise hat das Kinderspital eine höhere Baserate als das Universitätsspital. Am Inselspital hingegen hat die Kinder- und Erwachsenenmedizin die gleiche Baserate.
Zudem werden reine Kinderspitäler eher Forschung betreiben als integrierte Kinderkliniken.Das sehe nicht so. Ich denke, in Bern oder Lausanne wird qualitativ wie quantitativ gleich gute Forschung betrieben wie in Zürich oder in Basel. Einen Nachteil haben wir womöglich in der Finanzierung, da reine Kinderspitäler als Marke auftreten können und somit im Fundraising einen Vorteil haben.
Christoph Aebi
Professor Christoph Aebi, geboren vor knapp 56 Jahren, leitete von 2010 bis Anfang 2018 die Kinderklinik am Inselspital. Nun kehrt der Facharzt für Pädiatrie und Infektiologie zurück zu seinen Wurzeln und will wieder vermehrt in Forschung und Lehre tätig sein. Von 1998 bis 2010 leitete er am Berner Kinderspital die Infektiologie. Vorher wirkte er während vier Jahren im Rahmen eines Fellowship an der Universität von Texas in Dallas. Christoph Aebi studierte in Fribourg und Bern.
Was bringt die Nähe zu den Forschern der Erwachsenenmedizin?Sehr viel. Das wollte ich gerade sagen. Hier gibt es Synergien. Gerade in der Grundlagenmedizin gleichen sich Kinder- und Erwachsenenmedizin an.
In Bern sind die einzelnen Abteilungen der Kindermedizin der Erwachsenenmedizin angehängt. Finden Sie das gut?Das ist nicht so. Von den 13 Abteilungen ist bei uns nur die Kardiologie der Erwachsenenmedizin angegliedert. Und dies nur administrativ, nicht aber operationell.
Warum das?Wir haben vor acht Jahren das Zentrum für angeborene Herzfehler geschaffen. Betrieben wird es von der Kindermedizin, der Kinderintensivmedizin, von der Erwachsenenkardiologie und von der Herzchirurgie. Dieser Schritt war für uns positiv, da wir dadurch zusätzliche Kinderkardiologen anstellen konnten.
«Wir haben den Auftrag, unsere Wirtschaftlichkeit zu verbessern.»
Sie sagten, Teil einer Gruppe zu sein bringe wirtschaftliche Vorteile. Einer davon besteht wohl darin, dass die anderen Kliniken des Universitätsspitals ihre Defizite decken.Das mochte früher so gewesen sein. Doch mit der Einführung der neuen Spitalfinanzierung im Jahr 2012 werden Defizite nicht mehr durch die öffentliche Hand gedeckt. Wir haben den Auftrag, unsere Wirtschaftlichkeit zu verbessern.Ist das überhaupt möglich?In den letzten drei Jahren haben wir unsere Prozesse optimiert. Dadurch konnten wir den Kostendeckungsgrad im ambulanten Bereich von 60 auf 75 Prozent anheben. Das ist eine substantielle Verbesserung, aber der Kostendeckungsgrad ist natürlich immer noch ungenügend.
Entweder hatten Sie vorher zu lasch gearbeitet oder Sie mussten Leistungen abbauen.Optimierungen sind ein laufender Prozess. Verbesserungen erzielten wir unter anderem mit einem stets effizienteren Einsatz der IT. Zudem erzielten wir Verbesserungen in der Abrechnung, indem die erbrachten Leistungen auch wirklich abgerechnet werden.
Wie beim Jassen? Wer gut schreibt, gewinnt?Ja, so ist es. Alles selbstverständlich im legalen Rahmen. In der Kindermedizin ist es nicht immer einfach, die Leistungen der Ärzteschaft und Pflegeschaft im Tarmed vollumfänglich zu erfassen und korrekt zu verrechnen.
«Was wir mit höheren Taxpunkten generieren konnten, wurde mit dem tieferen Taxpunktwert zunichte gemacht.»
Sie sagten, der Kostendeckungsgrad sei nach wie vor ungenügend. Besteht in der Kindermedizin überhaupt die Möglichkeit, im ambulanten Bereich einen hundertprozentigen Kostendeckungsgrad zu erzielen?Das ist absolut unmöglich. Von 2016 auf 2017 hatten wir die Taxpunkte von 10 auf 11 Millionen erhöhen können. Gleichzeitig hat der Kanton Bern für die öffentlichen Spitäler den Taxpunktwert von 91 auf 86 Rappen pro Taxpunkt gesenkt. Was wir mit höheren Taxpunkten generieren konnten, wurde mit dem tieferen Taxpunktwert zunichte gemacht.
Also bleibt es beim Kostendeckungsgrad von 75 Prozent?Im Moment sind wir ausgeschossen. Ich sehe nicht, wie wir weitere Optimierungen erzielen könnten.
Was ist die Lösung?Auf Ende Mai ist beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) ein Treffen anberaumt, an dem wir das Problem der unterfinanzierten Kindermedizin besprechen wollen.
Der Tarifeingriff von Bundesrat Alain Berset wird kaum geholfen haben.Grundsätzlich unterstützen wir den Tarifeingriff, weil die Kindermedizin in Praxen davon leicht profitiert. Doch mit unserem Spitalambulatorium können wir davon nicht profitieren. Was der Tarifeingriff für uns konkret für Auswirkungen hat, lässt sich noch nicht abschätzen.
Spitalambulatorien sind ja generell unterfinanziert. Könnte man sagen, dass sie in Kinderspitälern erst recht unterfinanziert sind?Ja. Zwischen der Kinder- und der Erwachsenenmedizin gibt es im ambulanten Bereich einen ganz wesentlichen Unterschied: Bei der Erwachsenenmedizin wird ein grosser Teil der spezialisierten medizinischen Versorgung in Privatpraxen erbracht. In der Kindermedizin ist das nicht möglich. Hier sind die Spezialisten praktisch ausschliesslich in den grossen Kinderspitälern tätig. Wir haben die schlechten Risiken und eine hohe Kostenstruktur
«Das DRG macht oft ungenügende Unterschiede, obschon die Behandlung bei Kindern im Schnitt aufwendiger ist.»
Wie sieht es stationär aus?Im zurückliegenden Jahr hatten wir einen Kostendeckungsgrad von 95 Prozent.
Das überrascht. Agnes Genewein vom Kinderspital beider Basel kritisierte an dieser Stelle, dass es zu wenig kinderspezifische DRG’s gebe.Das ist richtig. Es mangelt an kinderspezifischen DRG’s. Und bei Fallpauschalen, die sowohl für Erwachsene wie für Kinder gelten, fehlt es oft an zusätzlichen Kindersplits und Untergruppierungen. Lungenentzündungen beispielsweise kommen bei Erwachsenen wie bei Kindern relativ häufig vor. Das DRG macht oft ungenügende Unterschiede, obschon die Behandlung bei Kindern im Schnitt aufwendiger ist.
Das DRG ist eben doch nicht das Gelbe vom Ei.Übers ganze gesehen ist das System mit Fallpauschalen flexibler und moderner als der Tarmed. Der Tarmed ist ein Zeittarif und nicht primär für Spitäler gedacht. Deshalb schneiden Spitalambulatorien im Vergleich zu Privatpraxen deutlich schlechter ab. Die schwierigeren und zeitaufwendigen Fälle werden logischerweise ins Spital zugewiesen. Wir brauchen also mehr Zeit pro Patient. Dem wird der Tarmed nicht gerecht.