
Hospital-at-Home kommt ans linke Zürichseeufer
Ab sofort können Patienten am linken Zürichseeufer über das See-Spital Horgen, die Hospital at Home AG und die Spitex Horgen-Oberrieden zu Hause statt im Spital behandelt werden.

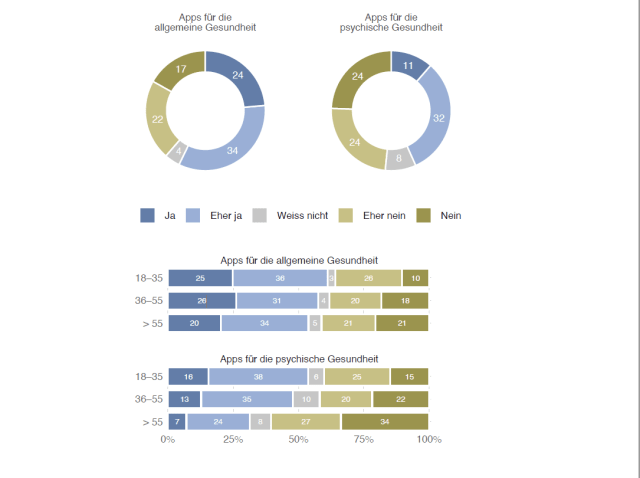
Loading

Ab sofort können Patienten am linken Zürichseeufer über das See-Spital Horgen, die Hospital at Home AG und die Spitex Horgen-Oberrieden zu Hause statt im Spital behandelt werden.

Das US-Magazin «Time» kürte die wichtigsten Innovationen des Jahres aus dem Gesundheitswesen. Die Auswahl zeigt: Fortschritt in der Medizin bedeutet heute vor allem neue Schnittstellen zwischen Mensch, Maschine und Methode.

Die Frauenklinik Fontana des Kantonsspitals Graubünden führt eine 4-Tage-Woche ein: 42 Stunden werden auf vier Tage verteilt, das Gehalt bleibt unverändert. Andere Spitäler sehen das Modell skeptisch.

Es gibt immer weniger Kinder, die unterernährt sind – dafür immer mehr, die zu viel essen. Auch in der Schweiz. Das zeigt der neuste Uno-Bericht.

Die Drogeriekette DM bietet neu auch Gesundheitsservices an. Der Konzern arbeitet mit professionellen Partnern – Fachärzte äussern Kritik.

Andreas Kistler über wirtschaftliche Zwänge, sinnentleerte administrative Aufgaben und die Entstehung von immer mehr Tätigkeiten, die keinen direkten Nutzen für Patienten stiften.

Das Inselspital wartete mit guten Meldungen auf. Doch der Insel-Kritiker Heinz Locher gibt keine Entwarnung.

Viele Ärztinnen und Ärzte überfordern sich – und glauben dann selber, dass sie über ihrem Können spielen. Das ist schlecht für die Psyche.

Bieler Ärzte schlagen eine neue Etikette für rezeptfreie Arzneimittel vor. Sie soll zeigen, wie verlässlich die Wirksamkeit nachgewiesen worden ist.