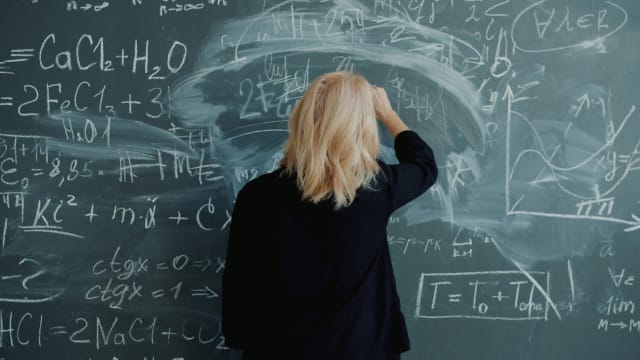Nie hätte sich
Elaine Schattner vorgestellt, dass sie lediglich 13 Jahre nach dem Ende der medizinischen Ausbildung ihren Beruf aufgeben und ihre Praxis schliessen würde.
Immer noch vermisse sie die Arbeit in der Klinik und dem Labor. «Der Tag, an dem ich meinen letzten Patienten sah, war einer der härtesten meines Lebens», schreibt die Spezialistin für Blut- und Krebserkrankungen in einem viel beachteten Bericht im Fachmagazin
Health Affairs. Darin liefert sie Einblicke in ihren Alltag als Ärztin und Patientin und den Preis, den sie dafür bezahlte.
Schattner kritisiert das «intensive, körperlich anstrengende und unnötig kompetitive Umfeld in der Schulmedizin», welches mit einer gesunden Lebensführung nicht zu vereinbaren sei. Ihr eigener Fall sei beispielhaft. Sie verknüpft ihn mit einer Botschaft, die lautet: Entschleunigung der medizinischen Praxis, um Gesundheit von Patienten und Ärzten zu schützen.
Elaine Schattner: «The Personal Toll Of Practicing Medicine», in: «Health Affairs», Februar 2017Arbeit nonstop
Mitte der 90er Jahre fühlte sich
Elaine Schattner voll im Saft. Von früh bis spät arbeitete sie im New York Presbyterian Hospital, wo sie für die Klinik für Onkologie und Hämatologie zuständig war, staatlich unterstützte Krebsforschung betrieb und in der Ausbildung tätig war. Waren die beiden Kinder abends im Bett, machte sie sich ans Aktenstudium.
Die meisten Wochenenden arbeitete sie auf Abruf - eine Zeit, die sie als «brutal» beschreibt. Sie habe zwar versucht, auf Montag zu verschieben, was sich verschieben liess, aber bei vielen Problemen ging es um Leben und Tod, die es unverzüglich zu lösen galt. Sie erwähnt den Fall einer jungen Frau, die frühmorgens an einem Sonntag mit Rückenschmerzen das Spital aufsuchte, ohne Gefühl in den Zehen. Diagnose: Krebs.
Trotz der Anstrengungen sei sie stolz gewesen, Ärztin zu sein, ihr Beruf habe sie glücklich gemacht. Der Ehemann habe sie unterstützt, die Söhne hätten nicht den Eindruck gemacht, unter ihrer Karriere zu leiden. «Ärztin zu sein, war essenziell für meine Identität», schreibt Schattner, die aus einer Arztfamilie stammt. «Zu sagen, ich liebte meine Arbeit, ist ein Understatement».
Depression
Detailliert beschreibt sie, wie sie Anzeichen von Schwäche ignorierte, besonders während ihrer Schwangerschaft. Sogar als sich einer ihrer Mentoren sich ernsthaft besorgt zeigte, antwortete sie: «Mir geht es gut.» Sie wollte weder den Vorgesetzten noch die Kollegen enttäuschen.
Aus Teamgeist versuchte Schattner, die Zeit, die sie während der Schwangerschaften und des Mutterschaftsurlaubs fehlte, wieder gutzumachen. Das bedeutete: Morgenrapport um 7.30 Uhr, Laborarbeit, Visite, Konferenz, Ausbildung, spätes Nachtessen ohne Familie. «Es war viel Arbeit, aber ich lernte konstant dazu und genoss es!», schreibt sie.
Elaine Schattner (Bild: elaineschattner.com)
«Keine Zeit für Brustkrebs»
Der Bruch kam 1998, als sie sich ein Video mit der Familie anschaute, in dem sie wie eine alte Frau aussah und darüber erschrak. Sie war ja erst 38 Jahre alt. Der Rücken schmerzte, zweimal pro Woche ging sie schwimmen. Zwei Jahre später verlor sie die für ihr Forschungslabor wichtigen staatlichen Zuschüsse. Den Ausfall versuchte sie durch Mehrarbeit zu kompensieren.
Bei einem Psychiater liess sie sich gegen Depressionen behandeln. Gegen die Rückenschmerzen nahm sie die Maximaldosen von Medikamenten wie Motrin, Tylenol und Vioxx. Trotzdem wurden die Schmerzen stärker. Den Kollegen sagte sie nichts. Nach vielen Untersuchungen war klar: Eine Rückenoperation war unumgänglich. In dieser Zeit machte sie der Internist darauf aufmerksam, dass in ihrem Alter eine Mammografie fällig wäre. Ihr erster Gedanke: «Ich habe keine Zeit für Brustkrebs». Sie hatte Angst um den Job.
Kollegen zur Last fallen
Die Mammographie ergab einen positiven Befund. Nach einem Armbruch erhielt sie zudem die Diagnose Osteoporose. Rückenoperation, Brustkrebstherapie, Osteoporose: Das war zu viel. «Ich war physisch und mental erschöpft». Als sie einen Vorgesetzten um Entlastung bat, schlug er nichts anderes vor, als weniger Zeit mit Patientengesprächen zu verbringen.
Das war für sie der Anlass, das Spital zu verlassen und in eine Praxis zu wechseln. Aber auch dort gelang es ihr nicht, die Arbeit zu managen und sich gleichzeitig um ihre eigene Gesundheit zu kümmern. Sie hatte vor allem das Gefühl, den Kollegen zur Last zu fallen. Wenige Jahre später entschloss sie sich, die Praxis zu schliessen - unfähig, Kollegen und Patienten den wahren Grund für die Schliessung mitteilen zu können.
Überhöhte Erwartungen
Im Nachhinein ist für sie klar, dass sie an überhöhten Erwartungen von ihr selbst und von Dritten gescheitert ist. Sie kritisiert, dass sich Ärzte in den Spitälern den Dienstplänen zu fügen haben, auch wenn diese unvernünftig und ungesund seien.
Sie spricht sich nicht gegen 50-Stunden-Wochen, nächtliche Konsultationen oder ein anstrengendes Wochenende aus - das gehöre eindeutig zum Beruf. Aber 60- bis 70-Stunden-Wochen über Jahre hinweg zehrten den Körper aus seien ein Risiko für die Gesundheit von Ärzten und Patienten, welche gegenseitig auf sich angewiesen sind.
Spirituelle Unterstützung
Elaine Schattner plädiert dafür, den medizinischen Alltag geruhsamer und bedächtiger anzugehen, weniger Patienten auf einmal zu betreuen. Als Vorbild führt sie die
Aliki-Initiative des Johns Hopkins Bayview Medical Centers an. Auch schlägt sie vor, den Spitalärzten zur Entlastung spirituelle Unterstützung zu bieten.
Heute, gut 10 Jahre nach der Schliessung der Praxis, geht es Elaine Schattner gesundheitlich besser, sie fühle sich glücklich. Sie arbeitet Teilzeit als Clinical Associate Professor am Weill Cornell Medical College und als Autorin für verschiedene Publikationen.