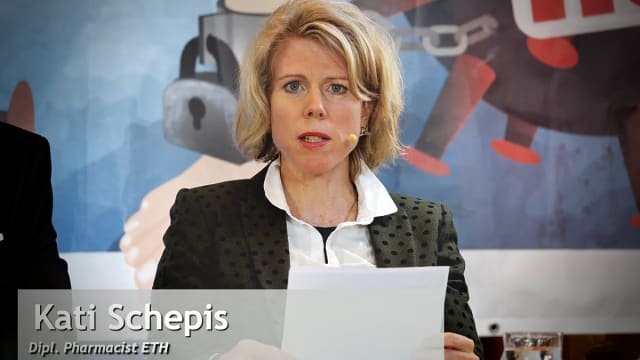Berater würden überzogene Honorare verlangen, hätten keine Praxiserfahrung und arbeiteten Tag und Nacht. Doch was ist wirklich dran an den «Berater-Klischees»? MedInside hat zwei gefragt, die es wissen müssen: François Muller (CEO) und Susanne Gedamke (Senior Consultant) von der Zürcher Healthcare Consulting Boutique Muller & Associés erzählen im heutigen Interview von begründeten und unbegründeten Vorurteilen und den grössten Herausforderungen im Alltag eines Beraters im Gesundheitswesen.
Eine existenzielle Frage zu Beginn: Warum genau brauchen Institutionen im Gesundheitswesen Sie als Berater?
François Muller: Entscheidungsträger im Gesundheitswesen müssen, wie es der Name ja schon verrät, Entscheidungen treffen. Wir helfen dabei entsprechende Grundlagen aufzubereiten und Entscheidungsprozesse zu begleiten. Beschlüsse müssen nachträglich aber oft erst noch umgesetzt werden. Hier helfen wir als externe Spezialisten im Projektmanagement Entscheidungen in die Praxis umzusetzen.
Susanne Gedamke: Es kann sehr hilfreich sein, für bestimmte Prozesse eine externe Person beizuziehen. Wir haben einen unabhängigeren Blick und sind weniger in dem jeweiligen Unternehmen sozialisiert. Zudem können wir Probleme oftmals direkter ansprechen.
Es wird oft gesagt, dass man sehr viel Berufs- und Lebenserfahrung haben muss, um eine Organisation glaubwürdig beraten zu können. Heisst das, man qualifiziert sich erst als guter Berater, wenn man das Pensionsalter erreicht hat?
François Muller: Sicherlich gehört eine gewisse Berufs- und Lebenserfahrung zu einem guten Berater dazu. Auf der anderen Seite ist eine gewisse Frische und Unbekümmertheit oft genau das richtige um für komplexe Probleme innovative Lösungen zu finden. Ich denke, eine gesunde Mischung macht es aus.
Susanne Gedamke: Eine gesunde Mischung ist ja generell hilfreich auf dem Arbeitsmarkt, nicht nur als Berater. Ich denke auch, dass es sich hierbei um zwei völlig unterschiedliche Qualifikationen handelt, die sich nicht gegenseitig ausschliessen: Erfahrungen auf der einen Seite und Offenheit für neue Ideen auf der anderen Seite. Das ist nicht ans Alter gebunden.
Wünschen Sie sich eigentlich nicht öfter mal, selbst im Sessel des Spitaldirektors, den Sie beraten, zu sitzen?
Susanne Gedamke: Nein, und das wäre auch ein ganz falsches Selbstverständnis. Es darf nicht Ziel eines Beraters sein, selbst die Chefposition zu besetzen. Wir unterstützen Entscheidungsträger und das funktioniert nicht, wenn man selbst in diese Position strebt.
François Muller: Genau. Ein Berater darf nicht das Rampenlicht suchen, er hält sich diskret im Hintergrund. Wer Chef spielen will, ist bei uns fehl am Platz.
Was macht einen Berater gegenüber seinem Kunden glaubwürdig?
Susanne Gedamke: Da unterscheiden sich Berater wohl nicht von anderen Berufen. Glaubwürdig macht man sich natürlich in erster Linie über Fach- und Methodenkompetenz. Ich finde es aber auch sehr wichtig, klar zu kommunizieren, ausnahmslos zuverlässig zu sein und realistische Erwartungen zu schaffen. Es bringt meinem Kunden nichts, wenn ich ihm Unmögliches verspreche, nur um gut da zu stehen. Um das zu vermitteln, hilft wiederum eine gewisse Sensibilität im Umgang mit Menschen.
François Muller: Ja, Sensibilität ist in der Tat ein wichtiger Bestandteil. Wir können einem Spitaldirektor nur glaubwürdig entgegentreten, wenn wir seine Herausforderungen auch richtig verstehen und nicht das Gefühl vermitteln dass alles mit einem Wisch lösbar ist. Dass wir selbst unternehmerisch tätig sind, kommt uns hier entgegen und schafft eine Kommunikation auf Augenhöhe.
Über Muller & Associés Healthcare Consulting
Die Beratungsgesellschaft
Muller & Associés Healthcare Consulting GmbH wurde 2014 von François Muller gegründet. Das Unternehmen mit Büros in der Schweiz und in Luxemburg bietet Institutionen des Gesundheitswesens Beratungsdienstleistungen an.
Muller & Associés verfügt über eine Expertise in der Optimierung klinischer und nicht-klinischer Prozesse, in der Entwicklung von innovativen Geschäftsmodellen sowie in gesundheitsökonomischen Fragestellungen.
Muller & Associés unterstützt Spitäler, Psychiatrien, Pflegeheime und andere Leistungserbringer im Gesundheitswesen, aber auch Regierungen in Strategie-, Prozess- und Organisationsfragen.
Man hört oft, Berater hätten überrissen Honorare? Was ist an dem Vorwurf dran?
François Muller: Ich habe das zum Glück noch nie direkt zu hören bekommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele die Honorare der Berater mit dem eigenen Salär vergleichen. Das ist natürlich falsch. Vom Honorar müssen Sozialabgaben, Ausbildungs- und Overheadkosten abgerechnet werden, die wir als Beratungsboutique tragen. Ferner ist es natürlich schon so, dass es insbesondere ein paar wenige Grossberatungen gibt die ganz üppige Honorare verlangen und diesen Ruf prägen. Das hat aber mit der Realität der grossen Masse an Beratungsunternehmen nichts zu tun.
Als Berater sind Sie sehr nah an einer Organisation, ohne aber direkt zu ihr zu gehören. Sind Sie gerne «Einzelkämpfer» oder fühlen Sie sich manchmal allein?
Susanne Gedamke: Es stimmt tendenziell schon, dass viele Berater sehr häufig allein unterwegs sind – auch wir. Allerdings haben wir natürlich auch noch ein Team um uns herum, mit dem wir eng zusammenarbeiten. Ausserdem haben wir ja ständig mit Kunden zu tun. Es ist also nicht so, als würden wir in der Mittagspause einsam am «Beratertisch» sitzen. So unbeliebt sind wir dann auch nicht (lacht).
François Muller: Wir pflegen auch einen intensiven Austausch innerhalb unseres Teams. Das ist gerade deswegen so wichtig, weil wir häufig allein unterwegs sind. Manchmal telefoniert man dann halt Abends im Zug miteinander oder schreibt Whatsapps. Aber wir sind eigentlich immer in Kontakt.
Die Beratertätigkeit wird zum Teil mit exorbitanten Arbeitszeiten in Verbindung gebracht. Wie häufig arbeiten Sie nachts?
François Muller: Nicht sehr häufig. Persönlich mache ich den Beraterjob nun seit zehn Jahren. Das ist wie bei einem Langstreckenlauf, sie brauchen einen guten und konstanten Rhythmus, der sie nicht einbrechen lässt. Ich persönlich versuche konstant mit 12 Arbeitsstunden am Tag auszukommen. Das gelingt eigentlich recht gut und vermeidet allzuviele Nachtschichten.
Welche Sorgen hat denn ein Berater?
François Muller: Jedes Projekt ist wieder neu und jede Organisation, die wir beraten wieder anders. Mich treibt oft um, ob die Ansätze, die wir für eine bestimmte Organisation entwickeln dann auch tatsächlich greifen. Ein zweiter Aspekt ist, dass Beratungsmandate oft kurzfristig angelegt sind. Du weisst ziemlich gut, was du nächsten Monat machst, bei 6 Monaten wird’s schon nebeliger und welche Mandate du in 1-2 Jahren begleitest, ist zumeist unklar. Da schwingt dann oft die Sorge mit, wie die Auftragslage mittel- und langfristig aussieht.
Susanne Gedamke: Diese Sorgen sind begründet und gleichzeitig hat eine gewisse Unsicherheit natürlich auch den Vorteil, dass der Job nie eintönig wird. Es lohnt sich also, diese Ungewissheit auszuhalten. Ausserdem passiert im Gesundheitswesen gerade so viel: Die Umsetzung des elektronischen Patientendossiers oder generell medizinisch-technologische Entwicklungen, die das System grundlegend verändern werden. Der Wandel der Patientenrolle, die ständige Herausforderung des Kostenanstiegs und ökonomische Anforderungen an Leistungserbringer – es warten noch viele komplexe Probleme auf uns.
François Muller: (lacht) ja, bei allen Sorgen, langweilig droht es nie zu werden.
Am Anfang haben wir bereits über Alter und Erfahrung gesprochen. Nun ist das nicht die einzige Auffälligkeit in der Beraterbranche: Warum gibt es so wenig weibliche Berater im Gesundheitswesen?
Susanne Gedamke: Vermutlich aus denselben Gründen, warum es weniger Spitaldirektorinnen oder andere weiblich besetzte Kaderpositionen gibt. Diese Problematik macht auch vor dem Gesundheitswesen nicht Halt. Im Gegenteil: Die Berufswahl ist zum Teil noch ziemlich geschlechtsspezifisch. Die Pflege wird z.B. zu einem grossen Anteil von weiblichen Mitarbeitern bewerkstelligt. In der Medizin spricht man seit einigen Jahren von «Feminisierung», wobei das – zumindest derzeit – in erster Linie für Abschlüsse im Medizinstudium und für bestimmte Fachrichtungen gilt und z.B. nicht für Chefarztpositionen. Von einer wirklichen strukturellen Gleichstellung sind wir also auch im Gesundheitswesen noch relativ weit entfernt.