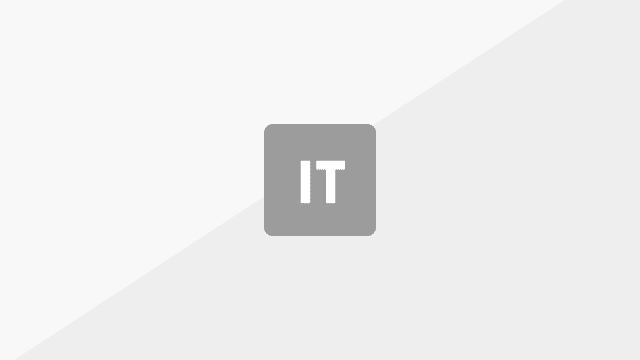Wer eine kleine Wunde an der Hand hat, führt sie instinktiv zum Mund - und macht damit vieles richtig. Nermina Malanovic und Karl Lohner vom Institut für Molekulare Biowissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz erklären das Verhalten so: «In der Körperflüssigkeit sind bestimmte Stoffe enthalten, die Keime abtöten».
Es handelt sich um ein bestimmtes Peptid, eine Kette an Aminosäuren, das antibakteriell wirkt. Solche Verbindungen sind im Körper nicht nur im Speichel, sondern auch in Tränenflüssigkeiten und weissen Blutkörperchen oder auf der Haut vorhanden.
Medizinische Anwendungen
Den dahinter liegenden Abwehrmechanismus haben die Forscher im Rahmen eines EU-Projekts geklärt: «Das positiv geladene Peptid löst gleichsam die bakteriellen Zellmembranen auf, die aus negativ geladenen Phospholipiden bestehen, und zerstört in der Folge die Bakterien», so Nermina Malanovic in einer
Mitteilung. Die Arbeit wurde im Fachjournal
«Science Translational Medicine» veröffentlicht.
Die Wirkung des Peptids, die mit Hilfe von Zellkulturen und im Tierversuch untersucht wurde, konnte in Form von Cremen auf der Hautoberfläche erfolgreich nachgewiesen werden. Es sei leicht und kostengünstig synthetisch herzustellen. Die Forscher sehen vielfältige Anwendungsbereiche, besonders angesichts der rapid steigenden Anzahl an antibiotikaresistenten Keimen.
Nermina Malanovic, Karl Lohner et al.: «The antimicrobial peptide SAAP-148 combats drug-resistant bacteria and biofilms» - in: «Science Translational Medicine», Januar 2018