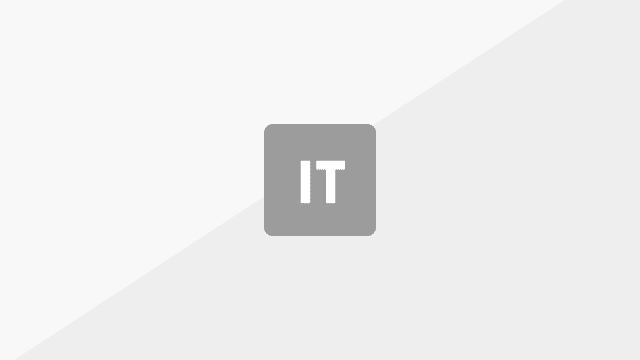100 Millionen für neue Medizin-Studienplätze: Das erscheint auf den ersten Blick eine feine Sache. Aber vielleicht ist der Bundesrat damit auch allzu eifrig vorgeprescht.
In einem offenen Brief an Bundesrat Johann Schneider-Ammann – plus einem
Communiqué – kommentiert jetzt der Vorstand der Erziehungsdirektoren-Konferenz EDK die neusten Pläne zum Thema Medizinstudium in der Schweiz. Und der Kommentar aus dem Kantons-Gremium ist voller leiser Bedenken.
Man begrüsst und bedenkt zugleich
Man erwarte vom Bund «ein koordiniertes Vorgehen beim weiteren Ausbau der Studienplätze in der Medizin», heisst es da etwa. Solch eine Pflicht zur Koordination sei immerhin durchs neue Hochschulförderungs-Gesetz vorgeschrieben.
Konkret geht es um die Erhöhung der Zahl der Medizin-Studienplätze: Bekanntlich
will der Bund 100 Millionen Franken investieren – und damit die Kantone dabei unterstützen, jedes Jahr 250 weitere Mediziner auszubilden; das Programm soll zwischen 2017 und 2020 laufen.
Da hat der EDK-Vorstand eigentlich nichts dagegen. Man begrüsse es «ausdrücklich», dass der Bund diese Mittel bereitstellen will: «Nachdem verschiedene Kantone mit einer eigenen medizinischen Fakultät in den vergangenen Jahren ihre Studienplätze für Medizin bereits deutlich erhöht haben, ist das ein wichtiges Signal seitens des Bundes.»
Doch damit das Geld nachhaltig wirken könne, brauche es ein koordiniertes Vorgehen von Bund und Kantonen – durchzuführen wohl im Hochschulrat.
Der Bund jedoch plane derzeit eine Projektausschreibung, und dies sei wohl kaum zielführend. Denn noch seien zum Beispiel der Mitteleinsatz und auch die Ziele des 100-Millionen-Projekt «aus Sicht des EDK-Vorstandes ungenügend geklärt».
Um was geht es eigentlich?
Eine interessante Frage der Erziehungsdirektoren lautet dabei: Geht es eigentlich darum, möglichst schnell möglichst viele neue Studienplätze zu schaffen? Oder gehören auch Reformen zum Paket?
Bei der ersten Version hiesse die Antwort wohl «mehr vom Gleichen». Wenn aber zugleich Neuerungen wie neue Ausbildungsgänge, kostengünstigere Varianten oder medical schools eingeführt werden sollen, dann benötige die Übung mehr Zeit. «Die Auflösung dieses Zielkonfliktes muss in erster Linie politisch erfolgen», so der Brief, der von Erziehungsdirektor Christoph Eymann (BS / LDP) und EDK-Generalsekretär Hans Ambühl unterschrieben ist.
Was passiert, wenn das Bundesgeld ausgegeben ist?
Die Kantone geben sich zwar offen für neue Ausbildungsmodelle und Ausbildungsstandorte. Eine solche Weiterentwicklung müsse «aber sorgfältig und koordiniert erfolgen». Denn eine Kernfrage lautet offenbar: Wer finanziert die neuen Medizin-Studienplätze, nachdem der Bund seine 100 Millionen bis 2020 ausgegeben hat?
Überhaupt lässt sich dies Skepsis aus den Schreiben der EDK herauslesen: Die Kantone fürchten den Einbau von neuen Kosten. Es bestehe ja wohl die Erwartung, «dass für das Sonderprogramm zusätzliche Mittel bereit gestellt werden, denn dessen Finanzierung darf nicht zulasten der Beiträge für die übrigen Hochschuldisziplinen, die Fachhochschulen und die Berufsbildung gehen.»
Heisst «nicht a priori geeignet» dasselbe wie «untauglich»?
Genau besehen melden die Erziehungsdirektoren – trotz der erwähnten «ausdrücklichen» Begrüssung – also fundamentale Bedenken gegen die Bundes-Medizinstudium-Spritze. Das Gefäss der projektgebundenen Aufträge sei «nicht a priori geeignet, eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Massnahme zu befördern», heisst es in der diplomatischen Höflichkeit.
Auch sei fraglich, ob diese Art der Bundesfinanzierung ein koordiniertes Vorgehen ermögliche – und solch eine Koordination ist ja, wie gleich anfangs und mehrfach betont wird, gesetzlich zwingend vorgeschrieben.