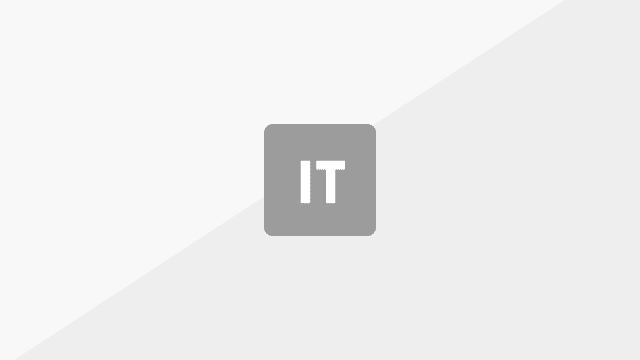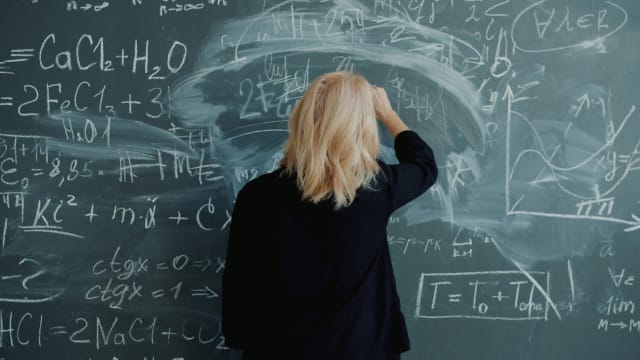Vielleicht ist die Zahl nicht besonders relevant, und sie findet sich auch nur an einer versteckten Stelle in den neuen
Gesundheitsstatistiken der OECD – aber zu denken gibt die Sache ja schon: In keinem anderen Land der westlichen Welt bleiben nach der Operation so häufig Instrumente oder andere Fremdkörper im Patienten wie in der Schweiz.
In Zahlen: Auf 100'000 Operationen passieren hierzulande 11,6 solcher «Never ever»-Ereignisse – also Fehler, die durch die Sicherheitsstandards eigentlich vollständig ausgeschlossen werden sollten.
Damit landet die Schweiz unter zwanzig untersuchten Industriestaaten am Schluss – und zwar klar.
Der Durchschnitt aller OECD-Länder liegt weniger als halb so hoch: Er erreichte 5,0 «foreign body left»-Fälle pro 100'000 Eingriffe.
Belgiens Quote ist zwanzig Mal tiefer
In den USA wurden statistisch 4,1 Ereignisse registriert, in Deutschland waren es 5,5 und in Grossbritannien riefen Medien und Patientengruppen jetzt zu gesetzlichen Schritten auf, weil das Land mit einer Quote von ebenfalls 5,5 im hinteren, schlechteren Bereich gelandet war (siehe
hierhier und hier). Zu bemerken ist, dass die Daten teils in verschiedenen Jahren erhoben wurden, die Schweizer Zahlen stammen beispielsweise noch aus dem Jahr 2010. Dennoch: Die Unterschiede sind klar und deutlich.
Die besten Ergebnisse lieferten beispielsweise Belgien, Dänemark und Israel – dort lagen die Werte zwischen 0,5 und 1,6. Am anderen Ende musste neben der Schweiz einzig Neuseeland eine Vergesslichkeits-Quote über 10 melden.
Wenn vier Fehler gleichzeitig passieren
Da stellt sich natürlich die Frage nach den Gründen. Dass der falsche Patient behandelt wird, dass eine Schere im Körper bleibt, dass das gesunde Glied amputiert wurde: So etwas geschieht nicht nur im faulen Witz. Vor einigen Wochen erst wurde der tragische Fall einer Tessinerin bekannt, die in der Clinica Sant'Anna von Soregno beide Brüste verlor –
weil man sie auf dem Operationstisch mit einer schwer brustkrebskranken Frau verwechselt hatte.
Solche fast undenkbarer Kunstfehler werden halt doch denkbar, wenn im Ops vier bis neun Fehler gleichzeitig aufeinandertreffen – beispielsweise ungenügende Abrede, Sprachprobleme, das Biegen von Regeln, aber auch der so genannte Bestätigungs-Bias: Man versteht eine andere Meinung am Ende doch als Bestätigung dessen, was man selber meint.
Dies ergab
kürzlich eine grosse Untersuchung der Mayo-Klinikgruppe in den USA. Immer jedoch lagen die untersuchten Grob-Kunstfehler an einem tieferliegenden Faktor – dem
human factor. Stets war es menschliches Versagen.
«Korrekte Zählung der Instrumente, Tücher etc.»
Weshalb wegen dieses Faktors ausgerechnet in Schweizer Operationssälen besonders oft etwas liegen bleibt, ist nun die offene Frage. Der naheliegende Verdacht: Hier wird seltener als in anderen Ländern mit Checklisten gearbeitet.
Bekanntlich gibt es eine «WHO-Checkliste», bei der die Chirurgen und Ops-Teams wie Piloten streng nach Formular vorgehen und alles abhaken, was kontrolliert wurde. Ein Punkt auf solch einer Checkliste lautet zum Beispiel: «Korrekte Zählung der Instrumente, Tücher, Tupfer, Nadeln etc.»
In der Schweiz aber wurde und wird solch eine Liste nicht standardmässig eingesetzt – oder oft auch nur unvollständig. Die
Stiftung Patientensicherheit arbeitet denn auch daran, alle Spitäler für den Einsatz solcher Abhak-Listen zu gewinnen. Die Daten der OECD könnten da Wasser auf die Mühlen sein.
«Foreign Body Left During Procedure in Adults», OECD 2011-2013: Anzahl vergessener Objekte pro 100'000 Spital-Eingriffe
- Belgien: 0,5
- Dänemark: 1,6
- Israel: 1,6
- Polen: 1,9
- Irland: 2,5
- Slowenien: 2,6
- Italien: 3,5
- Finnland: 3,9
- USA: 4,1
- Spanien: 4,3
- Schweden: 4,6
- Grossbrinannien: 5,5
- Deutschland: 5,5
- Norwegen: 6,0
- Frankreich: 6,2
- Portugal: 6,5
- Kanada: 8,6
- Australien: 8,6
- Neuseeland: 10,6
- Schweiz: 11,6
OECD-Durchschnitt: 5,0