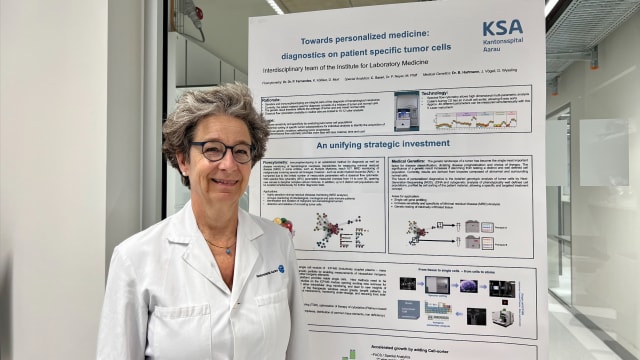Als Dr. med. et Dr. phil. nat II Paula Fernandez, Leitende Ärztin und Stv. Institutsleiterin Labormedizin, den Zellsortierer im KSA zeigt, leuchten ihre Augen: «Die Möglichkeiten, die uns dieses unscheinbare Gerät für die Behandlung unserer Patientinnen und Patienten bietet, sind zukunftsweisend.» Das KSA ist eine der wenigen diagnostischen Institutionen in der Schweiz, die über ein solches Gerät verfügt und international mit anderen vernetzt ist.
Bisher gab es in der Schweiz kein Spital, in dem ein Zellsortierer in der Diagnostik im Klinikalltag angewendet wurde. Aber schön der Reihe nach: Wozu braucht es überhaupt ein solches Gerät, das offenbar einfach Zellen sortiert?
Präzisere individuelle Therapie
Betrachten wir den Fall von Frau Amsteg, 74 Jahre alt, mit der Diagnose Multiples Myelom. Umgangssprachlich wird die Krankheit «Knochenmarkkrebs» genannt, da sich krankhafte Plasmazellen im Knochenmark unkontrolliert vermehren. Für die bestmögliche Therapie wird im KSA eine Knochenmarkbiopsie gemacht und die Probe untersucht. Das Team der Labormedizin arbeitet eng mit den anderen Fachdisziplinen im KSA zusammen. Mit sogenannter Flowzytometrie* kann es in der Probe die Krebszellen identifizieren und farblich markieren. Die Herausforderung: In der Probe sind gesunde und kranke Zellen vorhanden.
Eine DNA-Analyse der gesamten Probe liefert deshalb immer eine Mischung aller in der Probe enthaltenen Zellen..
Zellsortierung: Basis für personalisierte Medizin
Dank des Zellsortierers können die Zellen der Probe von Frau Amsteg im KSA nun viel genauer analysiert werden. Das hochspezialisierte Gerät kann Zellen auf der Grund-lage bestimmter Eigenschaften sortieren. Man kann sich eine Schüssel mit bunten Smarties vorstellen, bei der man nur die roten herausnehmen will: In Proben kann der Zellsortierer beispielsweise die Tumorzellen heraussuchen.
«Diese können wir danach separat untersuchen und deren genaues DNA-Profil identifizieren», sagt Dr. sc. nat. Britta Hartmann, Leiterin der Medizinischen Genetik am Institut für Labormedizin. Dadurch kann man die Therapie noch spezifischer auf die konkreten Tumorzellen abstimmen.
Genaue Überprüfung des Therapieerfolgs
Ein anderes Beispiel: Herr Schmid ist 59 Jahre alt und wegen Leukämie im KSA in Behandlung. Für Patientinnen und Patienten wie Herrn Schmid ist neben der differenzierten Erstdiagnose ein Messwert besonders wichtig: Die Rest-Tumor-Menge beschreibt die Anzahl verbleibender Krebszellen im Körper nach einer Behandlung.
Dieser Wert zeigt die Therapiewirkung wie auch das Risiko eines Rückfalls auf. Dank des Zellsortierers und genetischen Analysen lässt sich die Rest-Tumor-Menge im Zeitverlauf nun exakt bestimmen, was früher mit den Blutproben nicht möglich war. «Wir können genau messen, wie gut die Therapie anschlägt und wie viele krankhafte Zellen noch übrig sind. Dadurch kann man die Therapie wenn nötig frühzeitig anpassen», sagt Dr. Dr. Fernandez.
Sollte die Rest-Tumor-Menge unerwartet ansteigen, kann das Behandlungsteam frühzeitig eingreifen, lange bevor sich die Erkrankung in anderen Untersuchungen bemerkbar macht. Dadurch steigen die Heilungschancen drastisch.
Dr. med. et Dr. phil. nat II Paula Fernandez, Leitende Ärztin und Stv. Institutsleiterin Labormedizin, demonstriert den Zellsortierer.
Am Anfang
Und das ist erst der Anfang: Man stehe an einem Wendepunkt, sagt Dr. Dr. Fernandez. Man kann für gewisse Medikamente zukünftig mit den modernen Geräten sogar analysieren, wie gut diese in welche Zellen gelangen. Noch sei diese Technologie nicht flächendeckend verfügbar, aber sie weiss: «Das Potenzial für die personalisierte Medizin ist unbestritten.» Zellsortierer werden in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen, um Therapien individuell abzustimmen und die Präzision in Diagnostik und Therapie zu steigern. Am KSA wird diese transformative Technologie bereits heute Schritt für Schritt eingeführt, so dass mehr Menschen davon profitieren können.
* Bei der Flowzytometrie werden Zellen oder Partikel durch ein sehr feines Röhrchen (die sogenannte Flow-Zelle) geleitet, sodass sie einzeln an Sensoren vorbeifliessen. Diese Sensoren messen verschiedene Eigenschaften der Zellen, wie z. B. die Grösse oder Struktur. Zudem können bestimmte Moleküle auf der Zelloberfläche oder im Innern der Zellen farblich markiert und somit sichtbar gemacht werden.
Erfahren Sie unter
ksa.ch/labormedizin mehr zum Institut für Labormedizin am Kantonsspital Aarau.