
CHUV organisiert die Onkologieforschung neu
Die Forschung in den Bereichen Onkologie und Zelltherapie in Lausanne wird anders aufgeteilt. Rund fünfzig Stellen könnten gestrichen werden.

Loading

Die Forschung in den Bereichen Onkologie und Zelltherapie in Lausanne wird anders aufgeteilt. Rund fünfzig Stellen könnten gestrichen werden.

Insgesamt wird Brustkrebs in der Schweiz früh entdeckt. Handlungsbedarf besteht jedoch bei den Screeningprogrammen.

Als Qualitätsführerin in Medizin und Pflege gilt es, Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und das Angebot stetig weiterzuentwickeln. Damit es gelingt, dem steigenden wirtschaftlichen Druck wirkungsvoll zu begegnen.

Im Darmkrebsmonat März überraschte die Lindenhofgruppe die Berner Bevölkerung mit positiven Botschaften zur Vorsorge. Im Brustkrebsmonat Oktober folgt nun der zweite Teil der Kampagnen-Trilogie. Das Thema: Nachsorge bei Brustkrebs.
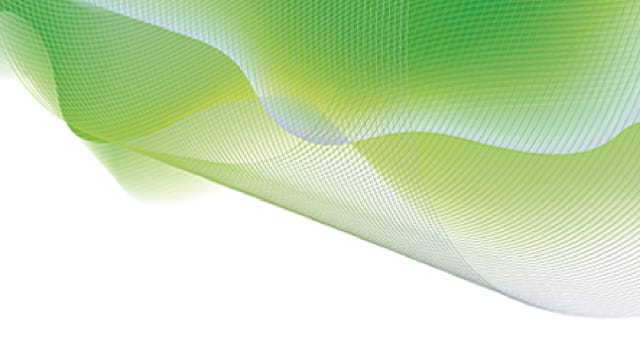
Die Onkologie ist ein ausgewiesener Leistungsschwerpunkt der Lindenhofgruppe.

Für seine internationale Studie zu Mycoplasma pneumoniae erhielt Patrick M. Meyer Sauteur von der Schweizerischen Gesellschaft für Infektiologie den ersten Preis.

Interpharma reagiert scharf auf die Veröffentlichung des Vernehmlassungsverfahrens zum Kostendämpfungspaket.

In der bevorstehenden Wintersession entscheidet das Parlament nicht einfach über die Gebühr für Bagatellfälle, sondern über die Gebühr für alle Behandlungen im Spitalnotfall ohne entprechende Überweisung.

Mit seinem zweiten Buch zieht der Freiburger Herzchirurg Bilanz. Persönlich, kritisch – und musikalisch begleitet vom Klang eines Alphorns.