2 x pro Woche
Abonnieren Sie unseren Newsletter.
Wirtschaftskrise könnte Leben retten
Eine Auswertung der grossen Finanzkrise und Rezession in Spanien – sowie der Mortalität von 36 Millionen Menschen – zeichnet ein erstaunliches Bild.
, 21. Oktober 2016 um 07:08
Ob es mit dem Risikoverhalten zu tun hat?
Artikel teilen
Loading
Comment
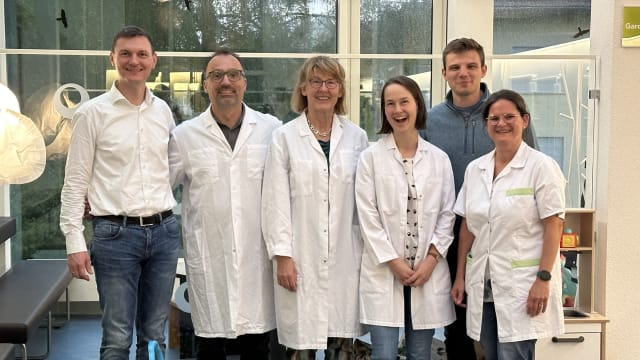
Ostschweizer Kispi und HSG: Gemeinsames Diabetes-Forschungsprojekt
Untersucht wird, wie sich Blutzuckerschwankungen auf die Nervengesundheit bei Kindern mit Diabetes Typ 1 auswirken - und welche Rolle Lebensstilfaktoren spielen.

Das «Time Magazine» ehrt noch einen Schweizer
Fidel Strub verlor seine rechte Gesichtshälfte an die Tropenkrankheit Noma. Seit Jahren kämpft er für deren Erforschung.

Insel-Chirurg mit dem Håkan Ahlman Award ausgezeichnet
Cédric Nesti wurde von der Europäischen Gesellschaft für Neuroendokrine Tumoren für eine Publikation über die Gefährlichkeit von Lymphknotenmetastasen.

Neues Prognosemodell weist auf Risiko für Opioidabhängigkeit hin
Unter der Leitung von Maria Wertli (KSB) und Ulrike Held (USZ) haben Forschende der ETH Zürich und der Helsana ein Modell zur Risikoeinschätzung einer Opioidabhängigkeit entwickelt.

Hirntumor-Risiko für Kinder: Entwarnung
Schuld könnten die kleinen Fallzahlen sein: Dass Kinder im Berner Seeland und im Zürcher Weinland mehr Hirntumore haben, ist wohl das Zufalls-Ergebnis einer Studie.

Seltene Krankheiten: «Oft spürt die Mutter, dass etwas nicht in Ordnung ist»
Wird dereinst das gesamte Genom des Neugeborenen routinemässig auf Krankheiten untersucht? In manchen Ländern wird das schon getestet, sagt Stoffwechselspezialist Matthias Baumgartner.
Vom gleichen Autor

Überarztung: Wer rückfordern will, braucht Beweise
Das Bundesgericht greift in die WZW-Ermittlungsverfahren ein: Ein Grundsatzurteil dürfte die gängigen Prozesse umkrempeln.

Kantone haben die Hausaufgaben gemacht - aber es fehlt an der Finanzierung
Palliative Care löst nicht alle Probleme im Gesundheitswesen: … Palliative Care kann jedoch ein Hebel sein.

Brust-Zentrum Zürich geht an belgische Investment-Holding
Kennen Sie Affidea? Der Healthcare-Konzern expandiert rasant. Jetzt auch in der Deutschschweiz. Mit 320 Zentren in 15 Ländern beschäftigt er über 7000 Ärzte.