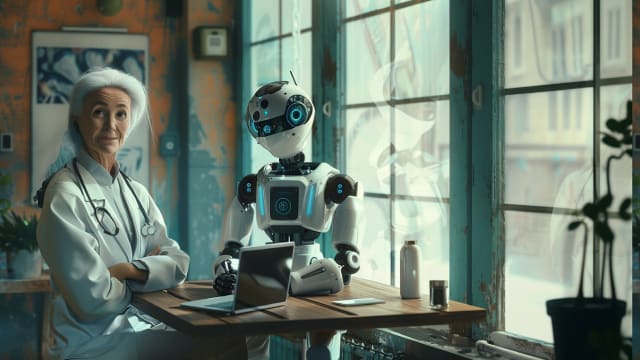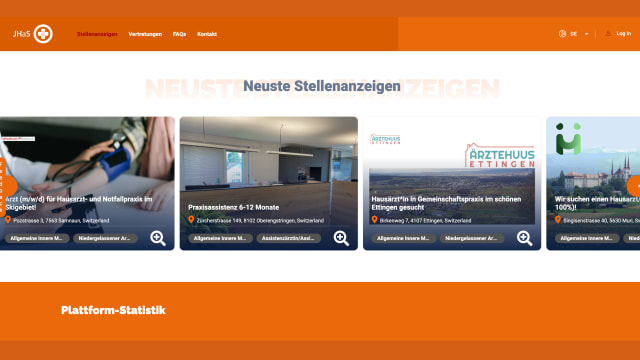Die ersten Reaktionen zeigen: Der Ärztetarif, der ab Januar 2018 gelten soll, stösst zwar auch auf Kritik – doch der Aufschrei ist einiges weniger laut als bei der Präsentation des Ursprungsprojekts im März. Und fast alle Seiten sind sich einig, dass dieser neue Tarmed eine Zwischenstation sein kann.
Die kritischsten Reaktionen setzte es erwartungsgemäss von den Leistungserbringern, insbesondere Ärzten (wobei zu sagen ist: Die FMH nimmt erst am Freitag in einer Medienkonferenz Stellung). Dabei kristallisierten sich aus Sicht der Praktiker zwei Hauptprobleme heraus – sowie eine grundsätzliche juristische Frage.
1. Notfallpauschale: Ist die Lösung praxistauglich?
Diesen Punkt bringt etwa die neue Mediziner-Organisation
SOS Santé vor. In ihrer
Stellungnahme befindet die «Allianz für Versorgungssicherheit», dass die bundesrätliche Neudefinition des medizinischen Notfalles nicht praxistauglich sei. Bekanntlich können laut den Bundesrats-Plänen gewisse Leistungserbringer (wie Rettungsdienste oder Permanencen) die so genannte Notfall-Inkonvenienzpauschale nur noch anrechnen, wenn bei den Patienten eine Störung der vitalen Funktionen vorliegt oder zu befürchtet ist.
SOS Santé erinnert dabei an Fälle wie ein Kind mit Ohrenweh, eine Patientin mit Blasenentzündung oder einen Patienten mit Ischiasbeschwerden – dies würde nicht mehr entschädigt. Funktioniert das?
Die Zürcher Ärztegesellschaft AGZ befürchtet hier sogar eine fatale organisatorische Nebenwirkung: Die geplante Neuorganisation des Notfalldienstes im Kanton Zürich – mit einer zentralen Triagestelle – werde durch das Tarmed-Verdikt aufs Spiel gesetzt. In der Praxis bedeute die Neudefinition der Landesregierung nämlich ganz einfach: Jene Fälle, die in den Verantwortungsbereich des geplanten Notfalldienstes fallen, würden nicht mehr als Notfälle gelten – und somit auch nicht mit der Pauschale entschädigt.
2. Zeitdauer der Grundkonsultation: Mehr Bürokratie?
Der andere Punkt: Die Grundkonsultation für alle Ärzte wird auf 20 Minuten veranschlagt – beziehungsweise auf 30 Minuten für Kinder und ältere Personen. Bei anderen Patienten mit erhöhtem Bedarf können die Leistungserbringer die Limitationen nach Absprache mit den Versicherern ebenfalls auf 30 Minuten erhöhen.
Dies könne «auf den ersten Blick als Entgegenkommen verstanden werden», vermutet SOS Santé. Doch die Lösung setze die Patienten und Ärzte der Willkür der Versicherer aus – und sie erzeuge zusätzliche administrative Aufwände.
Damit gerät ein weiteres Thema in den Fokus. Denn auf der anderen Seite hatten ja diverse Organisationen vorausgesagt, dass der Tarifeingriff wohl mit «kreativen Massnahmen» umgangen werde. Logische Folge: Der Versichererverband Curafutura fordert nun auch «eine seriöse Rechnungskontrolle der Versicherer sowie die Möglichkeit und Bereitschaft der Patientinnen und Patienten, die von Ärzten und Spitälern in Rechnung gestellten Leistungen genau zu überprüfen».
Die Stiftung für Konsumentenschutz verlangt nun ebenfalls intensivere Kontrollen: «Jetzt müssen Krankenkassen und Leistungserbringer sicherstellen, dass die neuen Regeln nicht umgangen werden können. Krankenkassen müssen die Rechnungen seriös prüfen, Leistungserbringer müssen den Patienten immer eine Rechnungskopie ausstellen.»
3. Ist der Entscheid überhaupt gültig?
Sehr fundamentale
Kritik bringt der Spitalverband H+ an. Auch er sieht ein Problem den «willkürlichen Zeitlimitationen», die den Ärzten für Vorabklärungen und Behandlungen weniger Zeit zugestehen. Die Ausnahmen für Kinder, Ältere und psychisch Kranke seien zwar zu begrüssen, aber ein Tropfen auf den heissen Stein.
Vor allem aber fragen sich die Spitäler, ob das Regierungspaket überhaupt gültig sei. Im Hintergrund steht ein
Entscheid des Kantonsgerichts Luzern zum letzten Eingriff des Jahres 2014. Der Befund dort: Da viele Tarife damals nicht aus betriebswirtschaflichen Gründen bestimmt wurden, sondern quasi nach dem «Prinzip Rasenmäher», sei dieser Tarmed nicht sachgerecht – was gegen das KVG verstosse. In diesem Fall liegt der Ball nun beim Bundesgericht.
Und für H+ ist aber klar: Auch dem Amtstarif 2018 fehlt die sachgerechte und betriebswirtschaftliche Bemessungsgrundlage. Also steht er auf ebenso wackligen juristischen Füssen wie sein Vorgänger.
Dabei sind die Spitäler vor allem empört darüber, dass der Bund die Anträge der Versicherer – basierend auf Schätzungen, Abrechnungsdaten und Rationierungen – weitgehend übernommen hat.
—