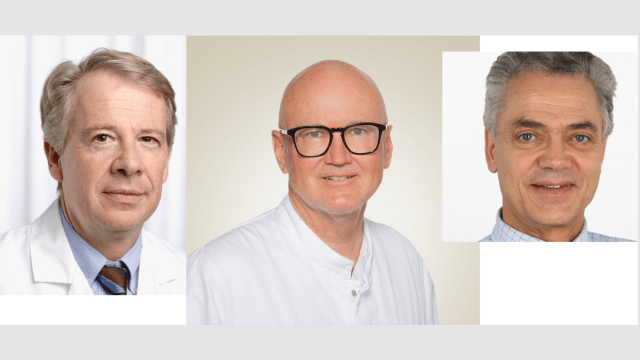Dieses Interview erschien in der neuen Ausgabe 5/2016 von
«Praxisdepesche», dem informativen Ärztemagazin.
Herr Professor Lehmann, wie sind Sie bei der Endokrinologie gelandet?
Das liegt sicher darin begründet, dass ich persönlich betroffen bin: Seit meinem 13. Lebensjahr habe ich selbst Typ-1-Diabetes. Ich wusste aber schon im Kindergartenalter, dass ich Arzt werden möchte.
Stammen Sie denn aus einer Arztfamilie?
Überhaupt nicht. Ich weiss nicht, warum ich schon immer Arzt werden wollte. Als ich dann plötzlich Typ-1-Diabetes hatte, hat mich das Ganze noch viel mehr interessiert. Zunächst wollte ich einfach eine gute Grundausbildung in Medizin haben. Danach stellte sich die Frage, wie man überhaupt eine Stelle im Bereich Endokrinologie bekommt. Es ist schwierig, wenn Facharztstellen über Jahre ausgebucht sind.
Roger Lehmann
Roger Lehmann ist Leitender Arzt an der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Klinische Ernährung am USZ. Zugleich ist er stellvertretender Leiter des USZ-Transplantationszentrums. Seine Dissertation «Markus, Barbara und viele andere: Mit Diabetes leben» ist ein Film. Seine ersten Stellen waren in der Pathologie und Chirurgie: «Sehr zu empfehlen! Hier kann man Wissenslücken aus dem Studium schliessen, praktisch Hand anlegen und kleinere Eingriffe vornehmen.»
Der Zufall wollte es aber, dass ich meine Dissertation bei E. Rudolf Froesch machte, dem damaligen Chefarzt der Endokrinologie am USZ. Damals wurde hier mehr Forschung denn Klinik betrieben, es gab keine wirklichen Assistentenstellen, um den FMH in Endokrinologie machen zu können. Ich fragte ihn vorsichtig, was er mir für die Zukunft empfehlen würde. Er sagte: «Ach, wissen Sie was, ich habe da schon eine Idee, machen Sie sich keine Sorgen. Ich organisiere irgendetwas.» Und dann hat er Giatgen A. Spinas als Oberarzt geholt, der heute die Abteilung leitet und bald pensioniert wird. Ich wurde Prof. Spinas’ Assistenzarzt, eine neu geschaffene Stelle.
«Wenn wir eine Idee hatten, haben wir das sehr einfach umgesetzt. Einer kurzen Besprechung der Idee folgten unmittelbar Taten»
Wir kannten uns schon von einem Diabeteslager, gingen dann gemeinsam nach Dänemark, um zu sehen, wie sie dort die Diabetes-Ambulanz betrieben. Dies hat einige Impulse für die Schaffung der Diabetes-Ambulanz am USZ gegeben. Heute sind wir ja eine mittelgrosse Abteilung mit vielen Untersuchungszimmern und Büros. 1992 gab es am USZ nur uns zwei, total verschupft (grinst). Ich hatte ein winziges Büro und Untersuchungszimmer, eine Koje in der damaligen Tagesklinik der Inneren Medizin. Diabetesforschung gab es immer viel am USZ, aber keine ambulante Betreuung. In fünfundzwanzig Jahren hat sich das total verändert und wir haben uns langsam zu einer mittelgrossen Klinik gemausert.
Dann ist Professor Spinas so etwas wie Ihr Ziehvater?
Ja, schon. Er ist neun Jahre älter als ich und hatte den Facharzttitel schon. Aber das Projekt, eine Diabetes- und Endokrinologie-Ambulanz am USZ zu schaffen, haben wir gemeinsam angefangen. Es war toll – wenn wir eine Idee hatten, haben wir das sehr einfach umgesetzt. Einer kurzen Besprechung der Idee und des Konzepts folgten unmittelbar Taten. Er hat mich auch sehr gefördert, wichtige Empfehlungen gegeben und mich dann bei der Umsetzung und bei der akademischen Karriere unterstützt.
Wenn Professor Spinas jetzt emeritiert wird, ist das sicher auch für Sie ein grosser Umbruch. Alles steht und fällt dann ja mit dem neuen Chef...
Ja, wobei man jeden Neuanfang auch wieder als neue Chance betrachten muss. Und ehrlich: Wenn man Medizin machen will, sowohl bei der Patientenbetreuung als auch in der Forschung, muss man nicht unbedingt der Chef sein. Es bedingt aber, dass man einen guten Chef oder eine gute Chefin hat, mit dem beziehungsweise mit der man harmoniert und der einen arbeiten und gute Ideen oder Projekte durchführen lässt.
Haben Sie Hobbys?
Ich reise sehr gerne, bin sehr viel mit dem Zelt unterwegs. Wenn ich es zusammenrechne, habe ich sicher zwei Jahre meines bisherigen Lebens in Nationalparks in Nord- und Südamerika, Asien, Südafrika und Australien verbracht. Ich fahre gerne Velo und wandere gern. Bis zu meinem 40. Lebensjahr war ich auch sehr aktiv mit Skitouren und Bergsteigen. Ich habe etwa zwei Drittel aller 4000er bestiegen, welche man mit Skiern erreichen kann, und fahre auch heute noch leidenschaftlich gerne Variantenski.
Wie sieht Ihr Feierabend in der Regel aus?
Sehr gerne setze ich mich abends aufs Mountainbike und drehe mit meiner Frau nochmals eine Runde im Wald für eine Stunde oder zwei. Ich grilliere aber auch sehr gerne ein gutes Stück Fleisch.
Ist eines Ihrer Kinder Arzt oder Ärztin geworden?
Meine Tochter hat initial an der ETH Molekularbiologie studiert und dann einen PhD in Cambridge gemacht und mich dann gefragt, ob ich sauer auf sie wäre, wenn sie noch etwas anderes studieren würde. Ich habe ihr gesagt: «Im Leben muss man einen Beruf ausüben, der einen glücklich macht, für den man Herzblut geben kann. Wenn Du das nicht hast, musst Du etwas anderes machen. Du bist noch jung, die durchschnittliche Lebensdauer einer Frau liegt bei über 80. Du musst noch sehr lange arbeiten und solltest mit Deiner Wahl glücklich sein.»
«Ich habe bei der Ausbildung zum Facharzt zwischen zwei Stellen immer wieder eine mehrmonatige Auszeit genommen und konnte mir so die Freude an der Arbeit immer bewahren»
Sie ist jetzt Veterinärin und sehr glücklich mit dieser Berufswahl. Der mittlere Sohn hat mit dem Medizinstudium begonnen. Vor kurzem war er bei mir auf der Station und wollte mir mal über die Schulter schauen. Das war schön. Ich finde es wichtig, gerade heute, dass man bei der Arbeit als Arzt nicht ausbrennt, sondern sich das Feuer bewahren kann. Das kann man erreichen, indem man in der Freizeit etwas total anderes macht. Oder eben bei der Arbeit die Abwechslung findet, so wie ich das mit Forschung und Klinik mache. Die Routine und die immer zunehmende Verwaltungsarbeit bringen einen sonst um. Ich habe bei der Ausbildung zum Facharzt zwischen zwei Stellen immer wieder einmal eine mehrmonatige Auszeit genommen und konnte mir so die Freude an der Arbeit immer bewahren. Nicht die Verwaltung ist das wichtigste, sondern die Patienten, auf die wir als Ärzte eingehen. Man sagt mir nach, dass ich immer so motiviert bei der Arbeit bin – es stimmt, weil ich es gerne mache!