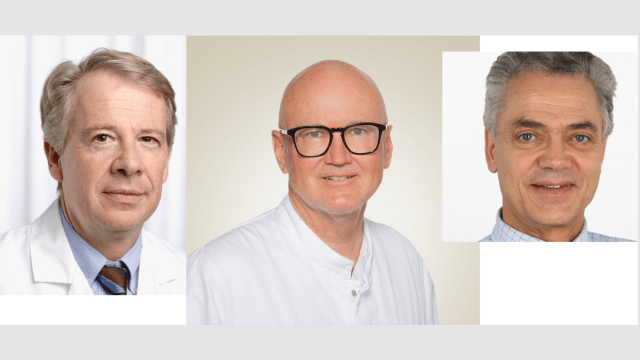Frau Schoppmann, Sie hielten am sechsten Pflegesymposium «Sprache und Dokumentation» der Psychiatrie Baselland ein Referat zum Verhältnis von Sprache und Pflege. Können Sie kurz zusammenfassen, um was es in Ihrem Vortrag ging?
Ich stellte die These auf, dass Pflegende wahre Sprachkünstlerinnen und Sprachkünstler sein müssen und versuchte dann darzulegen, wie ich dazu komme.
Sie haben unter anderem gesagt: «Wichtig ist nicht nur das reine Verständnis von Fachsprache, sondern auch die Fähigkeit zu wissen, mit wem wir in welcher Sprache kommunizieren sollten. Deshalb müssen Pflegefachpersonen wahre Sprachkünstlerinnen und Sprachkünstler sein.» Tatsächlich kommunizieren Pflegekräfte im Berufsalltag mit den Patienten üblicherweise in einer verständlichen und einfachen Sprache. Wenn sie sich mit ihren Mitarbeitern und Vorgesetzten austauschen, wird hingegen normalerweise die Fachsprache verwendet. Wie schwierig ist dieses ständige «Hin- und Herwechseln» aus Ihrer Sicht als Pflegewissenschaftlerin?
Eine Fachperson in der Pflege muss viele Sprachen sprechen, nicht nur die eigene, sondern auch die anderer Berufsgruppen – das kann schon zur Herausforderung werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel zur besseren Veranschaulichung: Eine Pflegefachfrau unterhält sich mit einer Patientin in der Eigensprache. Jeder Mensch hat seine eigene Sprache [
Idiolekt = Eigensprache]. Die Pflegefachfrau muss die Patientin gut kennen, um ihre Eigensprache erkennen, verstehen und nutzen zu können. Nun kommt eine Mitarbeiterin hinzu und schwupp, wechselt die Pflegefachfrau in die Fachsprache, in dem Fall in die Fachsprache der Pflege. Möglicherweise klingelt dann noch das Telefon: Eine Person von der Administration meldet sich, weil sie eine Frage zur Bettenbelegungssituation hat – die Pflegefachfrau muss erneut die Sprache wechseln. Vielleicht kommt dann noch eine Ärztin, in dem Fall verwendet die Pflegefachfrau die medizinische Sprache. Die Pflegefachfrau müsste zudem noch die Sprache der Informatiker, Betriebswirtschaftler, Kostenträger etc. verstehen – Sie sehen, die Liste ist lang. Die Pflegefachfrau muss also permanent die Sprache anpassen, je nachdem mit wem sie gerade spricht.
Das Symposium widmete sich insbesondere der Sprache in der psychiatrischen Pflege. Das ist ein Thema für sich.
In der Psychiatrie ist die Sprache in aller Regel das einzige Medium, welches den Pflegenden zur Verfügung steht. Anders ist es in der somatischen Pflege, da kann der Patient dem Pflegefachmann zeigen, wo er Schmerzen hat, und der Pflegefachmann kann auf der körperlichen Ebene vieles unternehmen, um das Wohlbefinden des Patienten zu fördern. Auch in der Psychiatrie ist es für die Pflegenden wichtig, dass sie die Körpersprache, Mimik und Gestik der Patienten richtig deuten können. Oft ist es aber auch einfach von Bedeutung, dass die Pflegenden das, was die Patienten zwischen den Zeilen sagen, verstehen. Hierfür ist eine gewisse Sensibilität für die Sprache sehr wichtig. Schaffen es die Pflegenden, die Eigensprachen der Patienten zu nutzen, ist dies förderlich, um eine vertrauensvolle Beziehung zu schaffen. Und diese ist wiederum die Basis jedweder Therapie.
Eine Eigenschaft, die eine gute Pflegekraft auszeichnet, ist Empathie. Wenn es um das Wohlergehen des Patienten geht, ist auch die sprachliche Sensibilität wichtig, wie Sie bereits angetönt haben.
Empathie ist sehr wichtig. Wenn man darunter die Fähigkeit versteht, sich in einen anderen oder zumindest in die Situation eines anderen hineinversetzen zu können, dann glaube ich, ist den Pflegenden schon viel an Beziehungsaufbau gelungen. Ich denke, fast jeder Mensch wünscht sich, von anderen verstanden zu werden, das ist ein sehr menschliches Bedürfnis. In diesem Zusammenhang finde ich noch erwähnenswert, dass heutzutage fast jede Klinik – egal ob in der Psychiatrie oder in der somatischen Medizin – auf der Homepage stehen hat, dass sie personenzentriert respektive patientenzentriert oder -orientiert arbeite. Im Vergleich zu früher geht man nicht mehr davon aus, dass die Mitarbeitenden der Klinik besser als der Patient wissen, was für ihn gut ist. Die Zeiten, in denen der Patient in die Klinik gekommen ist und gesagt hat ‹Machen Sie mich gesund›, sind vorbei. In aller Regel sind die Patienten sehr aufgeklärt und gut informiert, deswegen kommt der Empathie nochmals so viel Bedeutung zu. Heutzutage sind die Patienten Mitproduzenten ihrer eigenen Gesundheit; nicht die Person aus dem Gesundheitswesen macht den Patienten gesund, sondern das Genesen muss primär aus dem Patienten kommen. Die betroffene Person leistet dabei sicher einen so grossen Beitrag wie die helfende Person. Damit diese Co-Produktion gelingen kann, braucht es die Empathie als Transmitter. Und ja, angesichts dessen ist die sprachliche Sensibilität von grosser Bedeutung für eine erfolgreiche Behandlung.
«Die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse», sagt der kleine Prinz im Buch des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry. Stimmen Sie dem zu?
Das ist ein weiser Spruch. Ich glaube, Sprache ist eben dann die Quelle aller Missverständnisse, wenn man sich nicht klar macht: Mit wem spreche ich? Worüber spreche ich? In welcher Situation befinde ich mich? In der Regel stellen wir uns diese Fragen in Alltagsgesprächen ja nicht. Wenn ich etwa im Supermarkt bin und jemand fragt mich, ob ich wisse, wo der Zucker stehe, dann gebe ich Antwort, ohne dass ich vorher diese Fragen durchgegangen bin. Im beruflichen Kontext hingegen ist es wichtig, dass ich mir diese Fragen genau überlege. Zum Beispiel: In der Pflege wird mit sogenannten Pflegediagnosen gearbeitet, unter anderem um das Kommunizieren von komplizierten Sachverhalten zu vereinfachen. Solche Diagnosen sind nicht sehr wertschätzend formuliert, nehmen wir als Bespiel die ‹gestörte persönliche Identität›. Einer Patientin oder einem Patienten mit dieser Diagnose sage ich sicher nicht: ‹Ich möchte mit Ihnen an Ihrer gestörten persönlichen Identität arbeiten.› Dies wäre eine verletzende und missverständliche Äusserung. Ich würde es daher eher so formulieren: ‹Ich will mich gerne darum bemühen, Ihnen zu helfen und zu schauen, dass Sie sich selber wieder verstehen.› Um diese Art von ‚Übersetzungsleistung‘ erbringen zu können, sind die obigen erwähnten Fragen notwendig.
Eine Diagnose ist schnell gemacht. Wenn sich Pflegekräfte in die Patienten hineinfühlen, braucht das jedoch viel Zeit und auch Geduld.
Ich persönlich finde, das ist wirklich meine persönliche Meinung, dass es manchmal hilfreich ist, wenn man die Diagnosen nicht kennt. Diagnosen sind notwendig, das steht nicht in Frage. Sie sind aber auch Labels: Wenn der Pflegefachmann eine Diagnose hört, hat er sofort eine Assoziation – der Patient wird so reagieren und sich so verhalten. Kennt der Pflegefachmann die Diagnose nicht, ist er viel neugieriger, und darum geht es ja. Soll heissen: Wenn man Diagnosen wie ein Label nutzt – der Schizophrene, die Borderline-Gestörte etc. –, kann das den Blick auf den Menschen dahinter verstellen. Andererseits können gerade wegen der Diagnostik Zwischentöne und Sprache besonders wichtige Hinweise geben.
Nochmals zum Satz des kleinen Prinzen: Fällt Ihnen dazu eine passende Anekdote ein?
Mir fallen mehrere Anekdoten ein, die sich aus dem Unterschied zwischen der deutschen und der schweizerdeutschen Sprache ergeben. Ich komme ursprünglich aus Deutschland. In der Schweiz fragte ich mich anfangs oft: Was machen die Leute nur alle immer in der Post? Denn ich hörte die Leute sehr oft sagen: ‹Ich gah go poste.› Ein weiteres Beispiel: Auf einer psychiatrischen Abteilung fragte mich einmal eine Patientin sehr freundlich, ob ich ihr eine Linie geben könne. Ich war über diese Frage zutiefst empört und antwortete ihr: ‹Wir befinden uns in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus, hier werden keine illegalen Drogen ausgehändigt!› Daraufhin schaute mich die Patientin völlig verständnislos an – was sie wollte, war eine Telefonleitung.
Können Sie Pflegefachpersonen ein paar Tipps zur barrierefreien Kommunikation im Berufsalltag geben?
Ich denke, diese Frage lässt sich nicht allgemein beantworten. Was aber wohl in jedem Fall hilft: sich wach und offen auf das Gegenüber einzustellen.
Wenn die Sprachkenntnisse nicht ausreichend genug sind, ist oft keine oder zumindest keine zielführende Verständigung möglich. In der Schweiz war von 2011 bis 2017 der nationale Telefondolmetschdienst in Betrieb, von dem Spitäler, Hausärzte, Gesundheitsdienste etc. Gebrauch machen konnten. Das Angebot wurde vom Bundesamt für Gesundheit unterstützt. Die Nutzung des Dienstes blieb jedoch unter den Erwartungen. Deshalb wird dieser seit Frühling 2019 durch regionale Angebote ersetzt. Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach solche Angebote in Gesundheitsinstitutionen?
Der nationale Telefondolmetschdienst war mir bisher nicht bekannt. Ein Telefondolmetscher muss permanent zwischen den Sprachen hin- und herwechseln. Wenn er gut übersetzen will, muss er auch das, was zwischen den Zeilen steht, gut verstehen und in der anderen Sprache wiedergeben. Womöglich kommen noch kulturelle Unterschiede hinzu, die der Dolmetscher berücksichtigen sollte. Daher stelle ich mir diesen Beruf sehr herausfordernd vor. Aus Erfahrung weiss ich, wenn ich mit Freunden telefoniere, mit denen ich nicht dieselbe Muttersprache teile, dann ist das ungleich schwieriger, als wenn ich mit ihnen im gleichen Raum ein Gespräch führe. Telefoniert man in einer Fremdsprache, fehlen einem die Gestik und Mimik des Gegenübers, was einen grossen Teil dazu beiträgt, dass man versteht, was der andere gemeint hat, auch wenn man vielleicht nicht jedes Wort verstanden hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass dies mit ein Grund ist, weshalb der nationale Telefondolmetschdienst nicht so häufig genutzt wurde. Ich denke, die Kommunikation in Fremdsprachen funktioniert einfacher und besser per Videotelefonie als per normale Telefonie, weil man dann eben das Gegenüber sehen kann. In der Psychiatrie, wo die Sprache, wie bereits erwähnt, das einzige Medium ist, könnte die Videotelefonie tatsächlich sehr hilfreich sein.
André Nienaber, Direktor Pflege der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel, berichtete am Symposium über eine Sprachanalyse von Patientenakten in Zusammenarbeit mit Linguistinnen und Linguisten: «Die Bedeutung von Worten entsteht erst im Gebrauch», sagte er. Deshalb müsse darauf geachtet werden, wie die Dinge bezeichnet würden. Statt von Begriffen wie «Sitzwache» solle lieber von einer «intensiven Begleitung» oder von einer «Begleitung in akuten Krisensituationen» gesprochen werden. Inwiefern nützt das dem Patienten?
Ich stimme André Nienaber voll zu. Da ich schon lange im Pflegeberuf unterwegs bin, erinnere ich mich gut an die Zeiten, als ‹Sitzwache› tatsächlich bedeutete, dass Studierende neben die Patienten gesetzt wurden; sie haben gewacht und meistens nebenher ihre Lehrbücher gewälzt. Bei der ‹Begleitung in akuten Krisensituationen› hingegen weiss man sofort, dass sich der Mensch, um den ich mich kümmere, in einer existenziellen Krise befindet. Existenziell kann etwa heissen, dass die Person sich umbringen will. Halte ich sie mit meiner Anwesenheit davon ab? Wie gelingt mir das? Wie rede ich mit jemandem, der sterben will? Anhand dieser Fragen wird deutlich, dass es bei der ‹Begleitung in akuten Krisensituationen› eine ganz andere Qualifikation sowie andere Kompetenzen braucht als bei der ‹Sitzwache›. Letztgenannter Begriff impliziert dieses Bewachen, die ‹Begleitung in akuten Krisensituationen› stellt hingegen den Menschen ins Zentrum. Der Fokus ist hier mehr auf das Subjekt und weniger auf das Objekt gerichtet. Hinter Worten verbirgt sich eben auch immer eine Denkweise – unser Denken beeinflusst die Sprache und umgekehrt.
Kommen Ihnen noch weitere, überholte Begriffe aus dem Klinikalltag in den Sinn?
Es gibt viele, Nachtwache ist zum Beispiel auch so ein Wort. Es geht ja nicht einfach nur darum, nachts zu wachen. Vielmehr handelt es sich um einen Nachtdienst, in dem genauso gearbeitet wird wie am Tag.
Die Berufsbezeichnung «Krankenschwester / Krankenpfleger» ist nicht mehr zeitgemäss, schon länger heisst es «diplomierte Pflegefachfrau / diplomierter Pflegefachmann» – weshalb eigentlich?
Die korrekte Bezeichnung meines gelernten Berufs lautet tatsächlich noch Fachkrankenschwester für psychiatrische Pflege. Diese Berufsbezeichnung finde ich aber absolut nicht mehr zeitgemäss. Hinter dem Wort Krankenschwester verbirgt sich eine ganze Tradition, nämlich die der christlichen Krankenpflege. Bei den christlichen Pflegeorden, die es früher gab, stand das Dienen im Mittelpunkt. Ein grosses Motiv für diesen Beruf war auch das Bibelzitat ‹Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan›. Ob Pflegeorden, Diakonissen oder dergleichen: Das ist alles sehr ehrenwert. Nur: In der heutigen Krankenpflege kenne ich nicht mehr viele Menschen, die aus religiösen Motiven diesen Beruf ergriffen haben. Wenn man heute junge Menschen fragen würde, weshalb sie in die Pflege möchten, würden sicher viele antworten, weil sie gerne mit Menschen arbeiten würden, anderen helfen wollten. Es wird wohl aber kaum mehr jemand sagen: ‹Weil das ein Werk der Barmherzigkeit ist, mit dem ich Gott lobe.› Deshalb finde ich die Schweizer Lösung, von einer Pflegefachfrau oder einem Pflegefachmann zu sprechen, wunderbar. Auch weil in anderen Berufen Berufsangehörige Fachfrauen und -männer heissen. Damit reiht sich die Pflegefachfrau / der Pflegefachmann sozusagen in eine Bildungssystematik, in ein System von Berufsbezeichnungen ein.
Zur sachlichen Berufsbezeichnung «diplomierte Pflegefachfrau» haben die Patienten doch mehr Distanz – die «Krankenschwester» kann hingegen viel mehr mit positiven Emotionen assoziiert werden…?
Da bin ich jetzt neugierig: Was genau empfinden Sie an der Bezeichnung ‹diplomierte Pflegefachfrau› als sachlich? Was verbinden Sie mit der Krankenschwester, was Sie mit der Pflegefachfrau nicht verbinden?
Die Krankenschwester impliziert mehr Nähe, mehr Verbundenheit und ist vielleicht schon so etwas wie eine Familienangehörige…
…Die Schwester der Kranken also. Als ich vor 40 Jahren die Ausbildung zur Krankenschwester machte, sagte mein Bruder, er wolle nicht, dass ich eine kranke Schwester werde, er wolle lieber eine gesunde Schwester (lacht). Die Pflegenden sind real ja nicht die Familienangehörigen der Patienten, nichtsdestotrotz können sie relativ nahe Beziehungen zu den Patienten eingehen. In der Somatik wird dies sehr deutlich, etwa wenn die Pflegenden die Patienten waschen, dann ist dies eine intime Form von Begegnung, die sonst unter Erwachsenen nicht ohne Weiteres üblich ist. In der Psychiatrie werden die Pflegenden selten jemanden waschen, weil die Patienten dies in aller Regel selbst tun können. Es gibt aber andere Formen von Nähe, etwa indem die Pflegefachfrau oder der Pflegefachmann mit dem Patienten beispielsweise darüber spricht, wie er es erlebt, wenn er Stimmen hört. Das ist dann auch eine intime Begegnung; man kommt sich vielleicht gelegentlich näher, als man das üblicherweise in unserem Kulturkreis mit anderen Erwachsenen tut.
Was bringen Sie mit der «Pflegefachfrau» respektive dem «Pflegefachmann» in Verbindung?
Hinter der Bezeichnung ‹Pflegefachfrau› kommt doch zum Ausdruck, dass das jemand mit Fachwissen ist, der eine gute Ausbildung genossen hat. Das ist also jemand, der sein Fachwissen professionell anwenden kann. Diese Form von Professionalität, die da mitschwingt, tut es bei der Krankenschwester eben nicht.
Beschreiben Sie Ihre persönliche Beziehung zur Sprache.
Einiges habe ich bereits gesagt. Was ich aber noch erwähnenswert finde: Andere Lebewesen verständigen sich zwar auch – etwa mit Tönen –, aber diese Art von komplexer Sprache wie wir sie nutzen, ist etwas spezifisch Menschliches. Sprache schafft Kultur und ermöglicht uns zu denken, unser Zusammenleben zu gestalten und vieles mehr. Deswegen sollten wir die Sprache – ich sage es jetzt salopp – lieben und ehren. Auch sollten wir unsere Worte mit Bedacht wählen, denn sie können bekanntlich auch Waffen sein.
Welchen Begriff in der Pflege können Sie nicht mehr hören und weshalb?
Patientengut. Ich höre diesen Ausdruck zwar schon noch, habe aber das Gefühl, dass er allmählich verschwindet. Der Begriff wird noch gebraucht, wenn man über eine ganze Gruppe von Patienten spricht. Für mich ist Patientengut ein Unwort, weil es eben impliziert, dass die Patienten ein Gut, eine Ware sind. Das sind sie aber nicht, sie sind Menschen. Der Begriff ignoriert zudem das Leid, das mit jedweder Erkrankung verbunden ist.
Haben Sie auch ein «Lieblingswort»?
Professionelle Nähe ist ein Wort in der Pflege, das ich besonders mag. Speziell in der Psychiatrie wurde früher, etwa bis in die 2000er Jahre hinein, gelernt, wie wichtig professionelle Distanz sei. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wieder mehr gelernt wird, was professionelle Nähe bedeutet. Mit professioneller Nähe meine ich, dass ich jemanden nahe komme, aber eben auf eine professionelle Art und Weise, die sowohl mich als Menschen als auch als Berufsperson erfordert – das lässt sich ja nicht trennen. Die Berufsperson sollte sich immer bewusst sein, dass es um eine professionelle Nähe geht – Freundschaften, Liebschaften und dergleichen werden nicht entstehen, aber für einen bestimmten umschriebenen Abschnitt teilen die Pflegefachperson und der Patient etwas.
Zur Person
Susanne Schoppmann ist promovierte Pflegewissenschaftlerin und arbeitet seit 2015 an den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel in der Abteilung «Bildung, Forschung und Entwicklung» der Direktion Pflege.
Nachdem sie 1982 ihre Pflegeausbildung abgeschlossen hatte, war sie zuerst in der Psychosomatik und später in der Psychiatrie tätig. Dort hat sie in nahezu allen Fachbereichen und in verschiedenen Funktionen und Settings gearbeitet.