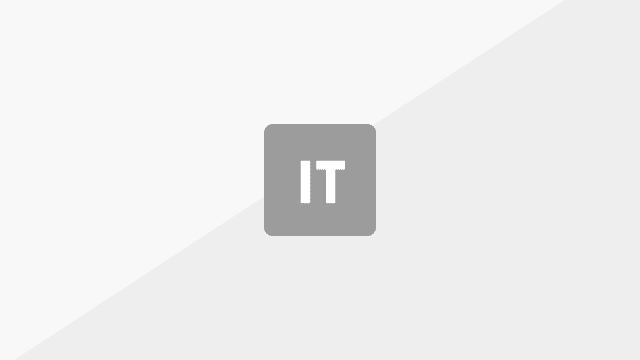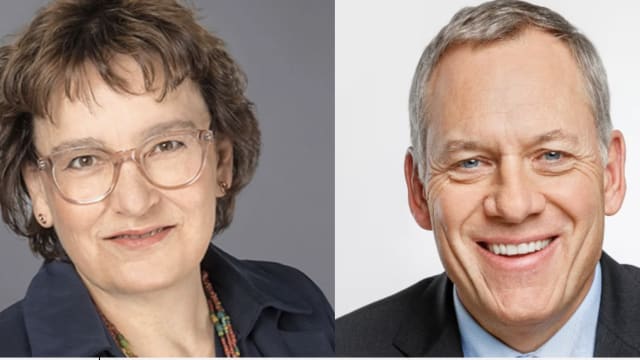Auf den ersten Blick geht es um Vereinheitlichung und Vereinfachung: Das BAG will die Zahl der Franchisen senken. Der Entscheid,
bekanntgegeben letzte Woche, erntete allerdings umgehend heftigen Widerspruch. Am meisten zu kritisieren gab etwa der Vorschlag aus dem Departement von Alain Berset, die höchste Franchisestufe abzuschaffen.
Die Idee hier: Da junge und fitte Menschen die hohe Wahlfranchise kühl zum Prämiensparen einsetzen, gibt es bei den Kassen faktisch gar nicht so viele Einsparungen durch die vermeintliche Risiko-Übernahme.
Anders gesagt: Die Solidarität in der Krankenversicherung wird hier teilweise ausgehebelt.
«Selbstselektion von Gesunden»
Aber was ist da dran? Dieser Frage gehen nun Christian Schmid und
Konstantin Beck nach; die beiden Ökonomen forschen am CSS Institut für empirische Gesundheitsökonomie in Luzern.
In der jetzt veröffentlichten Ausgabe der
«Schweizerischen Ärztezeitung» zitieren Beck und Schmid Daten, wonach es tatsächlich zu solch einer «Selbstselektion von gesunden Individuen in höhere Franchisestufen kommt». Greifbar wird dies zum Beispiel darin, dass bereits «teure» Versicherte bei Wechselmöglichkeiten seltener eine hohe Franchise wählen – während gesunde Leute dies durchaus zu nutzen wissen.
Andererseits lässt sich dem auch wieder etwas entgegenhalten – insbesondere den Risikoausgleich: Damit werden Gelder von den höchsten Franchisestufen in die günstigeren Stufen umverteilt. Die Ausführungen des BAG deuten nun aber an, dass dies nicht genügt – oder anders: Dass das Geschäft unrentabel ist und die Einsparungen nicht genügen.
Doch die alles entscheidende Frage ist, was unter dem Strich wirklich bleibt: Werden dank den Franchisen wirklich mehr Kosten eingespart werden – zum Beispiel, indem mehr Menschen vorsichtiger sind oder im Krankheitsfall zurückhaltender nach Arzt und Medizin rufen?
«Echte Kosteneinsparungen»
Die Gesundheitsökonomen aus Luzern zitieren nun Studien, wonach in den USA Spareffekte zwischen 25 und 30 Prozent nachgewiesen werden konnten.
Aber auch in der Schweiz gebe es mindestens zehn Untersuchungen zum so genannten Moral Hazard-Effekt – also zum Phänomen, dass man sich wegen einer Versicherung riskanter verhält, weshalb die kollektiven Einsparungen am Ende wieder pulverisiert werden. Eine Arbeit der Universität Bern wies beispielsweise 2005 einen Effekt von 12 Prozent für mittlere und von 27 Prozent für hohe Wahlfranchisen nach.
«Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die Wahlfranchisen in der Schweiz zu echten Kosteneinsparungen führen», so ein Zwischenfazit Schmid und Beck nach Diskussion aller vorliegenden Studien.
Am Ende würde die Prämienlast umverteilt
Die Gesundheitsökonomen gehen also davon aus, dass sich Selektionseffekt auch kostenneutral entwickelt, wenn weniger Wahlfranchisen zur Verfügung stehen; das heisst: Die Prämienverlagerung bei jungen und fitten Menschen einerseits, die durch sie entstehenden Kosten andererseits – wären nicht relevant.
Auf der anderen Seite dürfte eine Reduktion der Wahlfranchisen zu einer höheren Nachfrage nach medizinischen Leistungen führen – was wiederum die Kosten beeinflusst, also die Prämien.
Wie wäre also ein Abbau der Franchise-Palette zu beurteilen? Am Ende würden die Pläne des BAG nur die Prämienlast umverteilen. Schmid und Beck errechnen, dass 1,1 Milliarden Franken ein realistischer Wert sind. Oder anders: Um diese Summe beziehungsweise 5 Prozent der Krankenkassenleistungen würde die Nachfrage durch die geplanten Franchisenabbau steigen – und folglich auch die Prämien.
«Kaum ein geeignetes Mittel...»
«Eine Reduktion der Wahlfranchisen führt nicht zu tieferen Prämien, sondern zu einem Prämienanstieg von durchschnittlich rund 5 Prozent», schreiben die Ökonomen wörtlich. Wenn aber nur ein Teil des Kostenanstiegs durch die höhere Prämie jener Menschen bezahlt werden, die heute eine Spitzenfranchise haben, so müssten die anderen Versicherten den Rest finanzieren.
«Eine Reduktion der Wahlfranchisen schädigt auch diejenigen, die von der stärkeren Solidarität profitieren sollten, und ist daher kaum ein geeignetes Mittel, um die Solidarität in der Krankenversicherung zu stärken.»