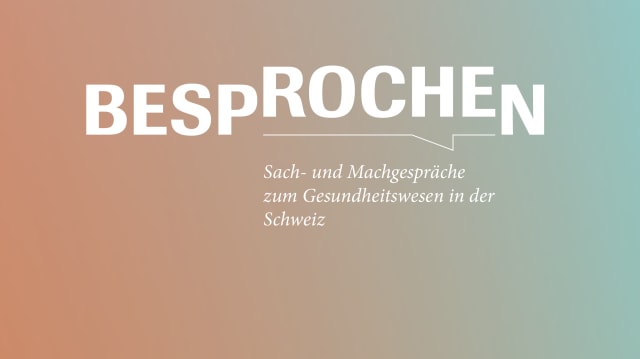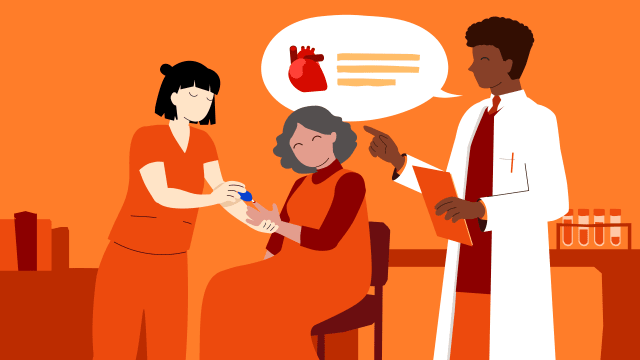Im Rahmen der Diskussionsreihe
«bespROCHEn», lud Roche im Mai 2023 zu einer virtuellen Diskussion zum Thema «Datennutzung bei seltenen Krankheiten - zwischen Sinnhaftigkeit und Bürokratie». Dr. Oswald Hasselmann (Kinderspital Ostschweiz), PD Dr. Christoph Neuwirth (Kantonsspital St. Gallen), beides ausgewiesene Experten der spinalen Muskelatrophie (SMA), und Remo Christen, Head Market Access & Healthcare Affairs bei Roche Pharma Schweiz, diskutierten dabei die konkreten Herausforderungen bei der Datenerhebung- und interpretation an eindrücklichen Beispielen aus dem Bereich der SMA.
Wie bei vielen seltenen Krankheiten ist auch bei SMA die Vergütung an die regelmässige Datenerhebung gekoppelt. Auf der Spezialitätenliste wird durch das BAG in der «Limitatio» genau geregelt, welche sogenannte Scores, wie etwa die Lungenfunktion, wann zu erheben sind. Dank diesen wird dann individuell evaluiert, ob eine Therapie wirkt.
Die Referenten waren sich einig, dass die Scores zwar medizinisch sinnvoll sind, aber die Lebensqualität und den Krankheitsverlauf von SMA nur unzureichend wiedergeben, da es ein breites Spektrum von Ausprägungen gibt. Für Dr. Hasselmann wird dabei den numerischen Werten eine zu grosse Wichtigkeit zugeordnet: «Soll beim Treppensteigen gemessen werden, wie viele Stufen in einer bestimmten Zeit bewältigt werden, oder sollte man fragen: Wie komme ich eigentlich die Treppe hoch? Mit einer Videoaufnahme des normalen Treppensteigens erfahren wir sehr viel mehr über die Lebensqualität und die Effektivität von Therapiemassnahmen, als über einen numerischen Wert.»
Für Remo Christen ist diese Frage eng verbunden mit dem Zugang zu innovativen Therapien. Vor diesem Hintergrund würden die Auflagen der Limitatio der Lebensqualität nicht genügend Rechnung tragen. «Wenn jemand sein Handy wieder bedienen kann, ist dies für die Lebensqualität entscheidend - aber in den meisten Scores nur unzureichend abgebildet, weshalb es zu Vergütungsproblemen kommen kann. Hier braucht es neue Lösungen, damit der Zugang zu einem Medikament sichergestellt ist.»
PD Dr. Christoph Neuwirth
Dr. Neuwirth betonte noch einen weiteren Aspekt, der mit dem individuellen Nutzen einer Therapie verknüpft ist: Trotz einer breiten Auswahlmöglichkeiten an guten Scores, sollte die Entscheidung, welchen Parameter man wählt, dem behandelnden Arzt und dem Patienten überlassen und nicht von aussen vorgegeben werden. «Das ist eigentlich eine Einmischung in die Therapiehoheit. Das kann nur das behandelnde Team, d.h. das Ärztepersonal, die Pflegefachkräfte, die Angehörigen, die Patienten selbst.»
Angeregt wurde auch über Sinn & Zweck der Datenerhebung diskutiert. Einig war man sich, dass eine Erhebung grundsätzlich unabdingbar sei. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass das Sammeln von Daten in einem zentralen Patientenregister aufwändig sei und sehr viel Zeit brauche. Darum sei es wichtig, sich klar zu sein, für was genau diese Daten verwendet würden, insbesondere auch im Hinblick auf Kostenkontrolle, wo auch andere Modelle zur Verfügung stehen würden. Aufgrund des hohen Aufwands für die Datensammlung wurde von Dr. Hasselmann auch gefordert, dass ein Teil der Unternehmensgewinne in die Langzeit-Datenerhebung fliessen sollte.
Wie können nun aber standardisierte Scores mit der Lebensrealität und dem individuellen Erleben der Patient:innen überhaupt zusammengebracht werden? In erster Linie brauche es eine Anpassung der Scores, die sowohl dem Alter, dem Krankheitsverlauf und auch der Erkenntnis der Erkrankung entspricht, um den individuellen Verlauf besser zu erfassen. Für die Referenten war zudem klar, dass es letztlich eine gesunde Mischung sei aus Daten, die die Patienten oder die Angehörigen selber berichten und numerischen Werten, die klar messbar sind. «Es ist aufwändig, aber letzten Endes reflektiert es doch das reale Leben», so Dr. Neuwirth. Schlussendlich seien diese kleinen Verbesserungen, die in den Scores nicht erfasst würden, entscheidend dafür, ob Patient:innen therapiert würden oder nicht. «Das hat nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine individuelle gesundheitliche Konsequenz», kommentierte Dr. Hasselmann. In dieser Hinsicht plädierte Remo Christen dafür, dass die Patient:innen und Patientenorganisationen im Rahmen der Preisverhandlungen ihre persönlichen Erfahrungen in die EAK (Eidg. Arzneimittelkommission) einbringen können. Und nicht zuletzt brauche es einen engeren und offeneren Dialog von Ärzten, Patientenorganisationen, Pharmafirmen und Gesundheitspolitikern.
Das gesamte Gespräch mit weiteren spannenden Einsichten finden Sie als schriftliche Fassung und als Recording auf
roche.ch.Über bespROCHEn: Mit dieser virtuellen Veranstaltungsreihe bietet Roche Schweiz eine Diskussionsplattform zu wichtigen Themen rund ums Gesundheitswesen in der Schweiz.
*08/2023 M-CH-00003538