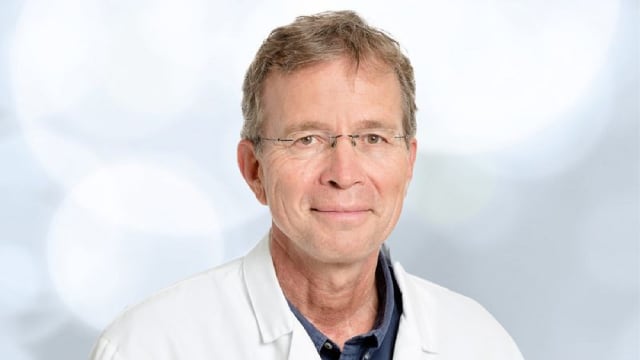Herr Kunz, welches ist die wichtigste Veränderung, die sie in ihrer 40-jährigen Tätigkeit im Bereich Palliative Care erfahren haben?
Vor 40 Jahren war Palliative Care inexistent; heute ist es eine eigenständige Fachdisziplin. Man kann sich zum Palliativmediziner ausbilden lassen, und in zahlreichen Spitälern sind Palliativstationen entstanden.
Sie erzählten mal in einem Interview, wie Sie am Anfang auf Widerstand stiessen, weil Spitäler keine Palliativstationen wollten, wo Leute sterben. Gibts das immer noch?
Für viele Leute, auch unter den Ärzten, kommt Palliative Care erst dann zum Zug, wenn man gar nichts mehr machen kann. Also kurz vor dem letzten Atemzug. Häufig wird Palliative Care auch in den Medien so dargestellt, als sei das eine Form von Sterbebegleitung.
Habe ich Sie richtig verstanden: Dieser Irrtum ist auch unter Ärzten verbreitet?
Die Spezialisten sagen etwa: «Nein, es ist noch nicht Zeit, wir kommen schon, wenn nichts mehr zu machen ist». Das ist der Widerstand, den wir noch erleben.
Also möchten Sie möglichst früh einbezogen werden?
Es geht darum, früh genug mit dem Patienten zu reden, um zu erfahren, was ihm wichtig ist, wo wir Grenzen setzen, wie wir die Zeit gestalten wollen, die ihm noch bleibt, damit er von dieser Lebenszeit noch etwas hat.
Ist es immer noch so, dass Spitäler alles daransetzen, möglichst wenig Todesfälle zu verzeichnen, um im Quervergleich gut dazustehen?
Ja, das ist vom Bund her so gesteuert. Das Bundesamt für Statistik wertet aus, wie viele Menschen in einem Spital sterben. Und hat ein Spital eine hohe Sterbequote, so heisst es, das sei ein schlechtes Spital.
Sie sind in der Schweiz so etwas wie der Guru der Palliative Care. Haben Sie im Bundesbern nicht genug Einfluss, um das zu ändern?
Ich habe den zuständigen Leiter im Bundesamt für Statistik darauf angesprochen. Er sagte, er sehe das ein. Er müsse aber derart viele Statistiken erstellen und so erhebe er Zahlen, die leicht greifbar sind. Er ist sich der Problematik bewusst. Aber die Zahlen sind nun mal da. Also will der Statistiker sie auch nutzen.
«Es gibt Situationen, in denen zu viel gemacht wird, weil der Patient nicht akzeptieren kann, dass es mit ihm zu Ende geht.»
Auf Medinside erschien kürzlich ein Artikel mit dem Titel «Palliative Care ist keine Sterbestation». Und doch sterben gemäss Ihren eigenen Aussagen 40 Prozent der Palliative-Patienten im Spital. Das ist doch eine recht hohe Zahl, wenn doch gesagt wird, die meisten möchten zu Hause sterben. Viele Leute kommen auf die Palliativstation, weil sie problematische Schmerzzustände haben. Dann werden sie behandelt, so dass es ihnen wieder besser geht und sie heimgehen können. Unter Umständen kommen sie ein zweites oder sogar ein drittes Mal. Und wenn sich die Situation verschlimmert, kommen sie auf die Palliativstation, wo sie auch sterben können. Vielfach ist es so, dass die Leute vorher noch ein oder zweimal nach Hause gehen.
«Wir machen ganz viel in den Spitälern, was dem Patienten wenig bringt oder sogar schadet.» Das sagte der Palliative-Mediziner Andreas Weber vom GZO Wetzikon in der Fernsehsendung «Club». Teilen Sie seine Meinung?
So ist mir die Aussage zu pauschal. Es gibt Situationen, in denen zu viel gemacht wird, weil der Patient nicht akzeptieren kann, dass es mit ihm zu Ende geht. Also macht man eine Chemotherapie, die Nebenwirkungen hat und eher schadet und viel kostet. Man macht das, weil man den Patienten nicht vor den Kopf stossen und ihm die Hoffnung nicht nehmen will.
Also sind die Patienten der Kostentreiber? Ich dachte, das seien eher die Spezialisten.
Das gibts natürlich auch, wo zu viel gemacht wird, weil wir im Alter immer weniger Grenzen haben.
Was meinen Sie mit Grenzen?
Als junger Spitalarzt erlebte ich vielfach Situationen, bei denen wir im Austrittsbericht eines 85-jährigen Patienten geschrieben haben: «in Anbetracht des fortgeschrittenen Alters musste auf weitere Behandlungen verzichtet werden». Der Anästhesist sagte uns, man könne den 85-jährigen Patienten nicht operieren. Nun hat sich die Medizin weiterentwickelt und der Anästhesist sagt uns beim 90-jährigen Patienten: «Eine Anästhesie kann ich auf alle Fälle machen. Ihr müsst entscheiden, ob es sinnvoll ist oder nicht.»
Zur Person
«Vor 40 Jahren wusste gar niemand, was Palliative Care überhaupt ist», erinnert sich Roland Kunz. Im Medizinstudium hat er darüber nichts erfahren. Nachdem er 1988 den Facharzttitel für Allgemeine Innere Medizin gemacht hatte, übernahm der damals 33-jährige Kunz die ärztliche Leitung des Pflegezentrums Oberi in Winterthur. Dort wurde er mit sterbenden Menschen konfrontiert und fing damit ans, sich als Autodidakt mit Palliative Care zu befassen, was damals buchstäblich ein Fremdwort war.
Von 2006 bis 2017 war Kunz am Spital Affoltern Chefarzt Akutgeriatrie und Palliativstation. Dann war er für drei Jahre Chefarzt der universitären Klinik für Akutgeriatrie am Stadtspital Zürich und weitere drei Jahre Chefarzt Palliative Care am Stadtspital Zürich.
Doch der Rentner, Jahrgang 1955, hat noch nicht genug: Seit März 2022 ist der Geriater und Palliativmediziner Leitender Arzt für Innere Medizin beim Spitalverbund Appenzell Ausserhoden.
Dank dieser Reparaturmedizin werden wir immer älter.
Man macht häufig, was möglich ist und nicht was sinnvoll ist. Die Frage nach dem Behandlungsziel und dem Lebensziel eines Menschen wird zu wenig gestellt. Nicht immer ist das, was man dem Patienten anbietet, wirklich das, was seinem Ziel entspricht.
Bin ich recht in der Annahme, dass Sie gegenüber Chemotherapie bei sterbenskranken Menschen skeptisch eingestellt sind.
Das kann man so nicht sagen. Ganz viele Menschen können dank der Chemotherapie unter Umständen noch viele Jahre ein gutes Leben führen. Ich bin dort skeptisch, wo man dem Patienten bei fortgeschrittener Krankheit keine Alternativen aufzeigt.
Haben Sie ein Beispiel?
Bleiben wir beim Krebspatienten. Da stellt man Metastasen in der Leber oder in der Lunge fest, und der Patient sagt: «Und jetzt?» Dann bekommt er als Antwort: «Jetzt müssen wir eine weitere Chemotherapie machen». Und man sagt ihm nicht, wie klein die Chance ist, dass die Chemotherapie am Krankheitsverlauf etwas ändern wird. Man sagt ihm nichts über die Nebenwirkungen und auch nicht, dass es Alternativen gibt.
«Oft haben mir Patienten kurz vor dem Tod gesagt: Wenn sie die Alternativen gekannt und gewusst hätten, was die Chemo alles mit sich bringt, hätten sie es nicht gemacht.»
Was sind das für Alternativen?
Man macht ein gutes Palliativkonzept und schaut, wie man eine bestmögliche Lebensqualität aufrechterhalten kann, damit allenfalls noch eine Reise gemacht werden kann, die man schon lange machen wollte. Ich habe wiederholt gehört von Patienten, die mir kurz vor dem Tod sagten, wenn sie die Alternativen gekannt und gewusst hätten, was die Chemo alles mit sich bringt, hätten sie es nicht gemacht.
Von den Alternativen, die Sie genannt haben, ist da auch Exit dabei?
Von mir aus biete ich Exit als Alternative nicht an. Wenn ein Patient nur noch ein paar Monate zu leben hat und immer schwächer wird und möglichst sterben will, zeige ich ihm auf, wie wir medizinisch Einfluss nehmen können. Wir besprechen mit ihm, welche Medikamente wir aussetzen und auf welche Behandlung wir verzichten können. Wenn er aber nicht warten will und eine Sterbehilfeorganisation in Anspruch nehmen will, so stehen wir ihm nicht im Weg.
Sie versuchen also nicht, ihn davon abzuhalten? Sind Sie pro Exit?
Ich akzeptiere, dass es Sterbeorganisationen gibt und dass ein beträchtlicher Teil der Leute diese Option wünscht. Die wenigsten nehmen sie aber in Anspruch. Von all den Mitgliedern, die bei Exit sind, macht am Schluss nur ein kleiner Bruchteil davon Gebrauch. Aber viele Leute fühlen sich erleichtert, wenn sie wissen, dass sie gegebenenfalls die Möglichkeit haben, mit Hilfe einer Sterbeorganisation aus dem Leben zu scheiden.
«Wenn eine Person 13 Tage bei mir auf der Station liegt, so bekomme ich nur eine Pauschale für 7 Tage. Wenn sie 14 Tage da ist, bekomme ich eine Pauschale für 14 Tage.
Man muss ja nicht Mitglied sein, um Exit in Anspruch zu nehmen. Es kostet dann halt einfach etwas.
Ja, nur vergeht dann eine relativ lange Zeit. Man kann nicht sagen, ich bin zwar nicht Mitglied, will aber nächste Woche sterben. Häufig sind dann die Menschen enttäuscht, wenn sie mehrere Wochen auf den Tod warten müssen.
Der Bundesrat ist derzeit daran, aufgrund einer Motion die Tarifierung und Finanzierung der Palliative Care zu klären. Wo gibts Handlungsbedarf?
Auf allen Ebenen. Für die Palliative Care ist das System der Fallpauschalen (DRG) wirklich ein Problem. Das Spital erhält einen bestimmten Betrag für eine bestimmte Behandlung. Je kürzer die Behandlung, desto besser. In der Palliative Care gibt es pro Woche eine bestimmte Pauschale. Wenn eine Person 13 Tage bei mir auf der Station liegt, so bekomme ich nur eine Pauschale für 7 Tage. Wenn sie 14 Tage auf der Station liegt, so bekomme ich eine Pauschale für 14 Tage. So haben wir schnell mal ein ethisches Problem. Was geschieht, wenn man nach 12 oder 13 Tagen merkt, dass es nur noch um Stunden geht? Lässt man der Natur freien Lauf oder sorgt man dafür, dass die Person noch etwas länger lebt und zusätzliche 10'000 Franken in die Spitalkasse spült?
Ist es nicht so, dass die bezahlte Dauer gegen oben limitiert ist?
Nach drei Wochen auf der Palliativstation gibts kein Geld mehr. Ist dann keine Entlassung vertretbar, wird es für das Spital problematisch.
«Hospize haben einen besseren Personalschlüssel als ein Pflegeheim, sie haben höhere Personalkosten. Sie sind aber gleich finanziert wie Pflegeheime.»
Wie siehts bei jenen aus, die zu Hause sterben wollen?
Palliativpatienten sind angewiesen auf einen Arzt oder eine Ärztin, die Hausbesuche machen. Die werden aber immer seltener. Dann braucht es Spitexorganisationen mit dem notwendigen Knowhow und einem Pikettdienst auch nachts. Wer das anbietet, muss Vorhalteleistungen erbringen, die aber nicht finanziert sind. Deshalb können nur grosse Spitexorganisationen das anbieten. Das führt dazu, dass viele Leute, die eigentlich zu Hause sterben möchten, die benötigten Leistungen nicht bekommen und in teureren Einrichtungen untergebracht werden müssen.
Zum Beispiel ins Pflegeheim.
Auch hier ist die Finanzierung nicht gelöst. Das Personal in einem Pflegeheim hat eine gute Grundausbildung in der Betreuung von alten Menschen mit all ihren Altersbeschwerden. Wenn aber am Lebensende komplexere Probleme auftreten, die man mit normalen Schmerzmitteln nicht in den Griff bekommt, braucht es palliative Unterstützung. Dazu gibt es Palliative-Spitexen. Wenn aber solche spezialisierten Pflegefachpersonen mit einer Palliative-Care-Ausbildung in einem Pflegeheim beigezogen werden, könnten die Patienten enorm profitieren, nur dass niemand diese Leistung bezahlt.
Spitex zu Hause ist bezahlt; Spitex im Heim ist nicht bezahlt?
Das Heim erhält pro Patienten eine Pauschale. Wenn es Palliative-Spezialisten beizieht, muss es das selber finanzieren.
Fehlen noch die Hospize.
Sie sind ausgerichtet für Palliativpatienten, auch für jüngere. Hospize haben einen besseren Personalschlüssel als ein Pflegeheim, haben höher ausgebildetes Personal und daher höhere Personalkosten. Sie sind aber gleich finanziert wie Pflegeheime. Mit jedem Tag, an dem sie einen Patienten betreuen, bleibt ihnen ein Verlust. Diese Lücke wird durch Spenden oder vom Patienten selber gedeckt, wenn er dazu die Mittel hat.