
Ein Oensinger Gesundheitszentrum betreibt den ersten «Medicomat» in der Schweiz
Das Gerät im Vitasphère-Gesundheitszentrum funktioniert wie ein Getränkeautomat. Doch statt Flaschen gibt der Automat rund um die Uhr Medikamente heraus.

Loading

Das Gerät im Vitasphère-Gesundheitszentrum funktioniert wie ein Getränkeautomat. Doch statt Flaschen gibt der Automat rund um die Uhr Medikamente heraus.

2024 erhielten Ärzte, Spitäler und Fachgesellschaften zusammen 262 Millionen Franken – 16 Millionen mehr als im Jahr davor.

Der Markt für Krankenhaus-Informationssysteme (KIS) befindet sich in einer Phase tiefgreifender Transformation. Die aktuellen Trends und Herausforderungen der Branche sowie die Erwartungen der Kliniken beleuchtet Dirk Müller, Director Product Management CIS4U bei Dedalus HealthCare.

Im Unterschied zum Ständerat will der Nationalrat nichts wissen von einer erleichterten Einfuhr patentabgelaufener Medikamente.

Der Ständerat will nicht, dass Kosten gespart werden, indem der Kauf von Medikamenten im Ausland zulasten der Grundversicherung ermöglicht wird.
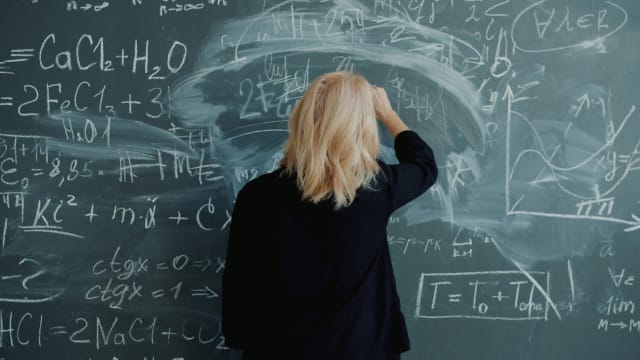
Laborwerte, Risiken, Therapieeffekte – viele Aufklärungsgespräche scheitern an medizinischen Zahlen. Doch wie erläutert man, was eine Behandlung bringt? Ein Vorschlag.

Bei einer Patientin traten nach einer Darmspiegelung unerwartet schwere Komplikationen auf. Das Bundesgericht stellt nun klar: Die Ärztin aus dem Kanton Aargau kann sich auf die «hypothetische Einwilligung» der Patientin berufen.

Neue Studie aus den USA wirft Fragen auf: Wettbewerb allein garantiert keine besseren Operationsergebnisse.

Während der Ausbildung nimmt das Einfühlungsvermögen von angehenden Ärztinnen und Ärzten tendenziell ab: Das besagt eine neue Studie.