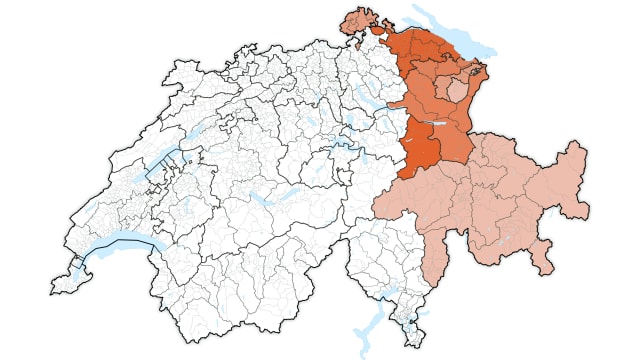Frau Gilli, Sie sagen, wäre die Kostenbremse-Initiative vor 20 Jahren eingeführt worden, könnten 37 Prozent der Leistungen nicht mehr in der Grundversicherung angeboten werden. Ist das nicht eine etwas fahrlässige Behauptung?
Das ist keine Behauptung. Das ist faktenbasiert. Gemäss den Übergangs-Bestimmungen darf das Wachstum der Gesundheitskosten nicht mehr als 20 Prozent über der Lohnentwicklung liegen. Daran haben wir uns orientiert.
Wer das politische Geschehen so lange verfolgt wie ich, hegt tendenziell Zweifel an solchen Studien.
Wir machten noch eine andere Berechnung und untersuchten die Kostenentwicklung in Bezug auf die Alterung. Auch bei dieser Betrachtung wurde das Kostenwachstum überschritten. Schliesslich kommt auch die Expertenkommission, die den Bundesrat beraten hat, auf ein höheres Kostenwachstum als sich dies die Initianten vorstellen. Deshalb wäre die Versorgung bei einem Ja zu dieser Initiative wirklich gefährdet.
Yvonne Gilli, 1957 geboren, sitzt seit 2016 im Zentralvorstand der FMH; seit 2021 ist sie deren Präsidentin. Von 2007 bis 2015 sass die St. Gallerin für die Grünen im Nationalrat. Sie ist Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, zudem verfügt sie über den Fähigkeitsausweis FMH in klassischer Homöopathie und Traditioneller Chinesischer Medizin.
Den Initianten macht man den Vorwurf, die Initiative sei zu offen formuliert. Und gleichzeitig will man herausgefunden haben, was eine Umsetzung vor 20 Jahren für Konsequenzen gehabt hätte.
Die Initiative ist überhaupt nicht zu offen formuliert. Sie beinhaltet einen starren Mechanismus. Man könnte höchstens einwenden, dass die Initianten keine konkreten Massnahmen zur Kostensenkung vorgeschlagen haben. Politikerinnen und Politiker hüten sich natürlich davor zu sagen, wie konkret die 37 Prozent der OKP-Kosten einzusparen sind.
Als mögliche Massnahme war im Parlament zu hören, dass bei einem zu hohen Kostenwachstum die Tarifpartner die Tarife anpassen müssten.
Das würde aber heissen, dass gewisse Leistungen nicht mehr erbracht werden könnten, weil sie nicht mehr kostendeckend sind.
Das könnte man durchaus auch als Angstmacherei bezeichnen.
Dass das keine leere Drohung ist, kann man in den Nachbarländern beobachten, die Budgetvorgaben gemacht haben. Nehmen Sie als Beispiel Deutschland. Dort haben sie für Allgemeinpraxen Budgetvorgaben gemacht. Weil das aber zu einer Mangelversorgung führte, macht Deutschland genau das rückgängig, was die Kostenbremse-Initiative einführen will.
Wir werfen Medikamente im Gegenwert von fast vier Milliarden Franken in den Abfall. Müsste man nicht solche Sachen anpacken?
Da haben Sie vollkommen recht. Jedes Gesundheitssystem hat seine Schwächen. Sie weisen auf etwas ganz Wichtiges hin. Hier könnten wir auch von Nachbarländern lernen. Ein einfacher und wichtiger Beitrag wäre zum Beispiel, dass es Ärztinnen erlaubt wäre, genau diejenige Anzahl an Tabletten abzugeben, die es für eine bestimmte Behandlung braucht.
Das Kostenwachstum ist in den vergangenen Jahren flacher geworden. Wir haben in der Schweiz eine sehr gute Kostenkontrolle. Und was zum Beispiel die Hausarztmedizin betrifft, so sind die Kosten pro Patient in den letzten Jahren stabil geblieben. Unabhängig davon sind aber die Prämien übermässig gestiegen. Hier besteht Handlungsbedarf.
Streiten sie ab, dass sich viele Ineffizienzen im System eliminieren liessen, wenn man nur wollte?
Ich finde das eine spezielle Aussage. Es gibt in jedem System Ineffizienzen, nicht nur im Gesundheitswesen. Die Realität ist nie perfekt.
Es geht doch darum, dass die Politik keine Bemühungen unternimmt, endlich die Kosten in den Griff zu bekommen.
Das stimmt einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie man solche pauschalen Aussagen machen kann. Ich könnte ihnen zig Massnahmen nennen, die konstant ergriffen werden, um die Kosten unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig die Versorgung der Bevölkerung zu optimieren. Einen idealen Zustand werden wir nie erreichen. Aber wir müssen uns konstant bemühen, dass wir erkennbare Fehlanreize beseitigen. In den letzten vier Jahren hatten wir 44 Revisionen des KVG, die sich nun in der Umsetzung befinden.
Was sagen Sie zur Aussage des Bundesamts für Gesundheit, wonach 20 Prozent der Behandlungen unnötig seien?
So gesagt ist das falsch. Das ist eine theoretische Gesamtbetrachtung, mit der theoretisch möglichst vollständig die Ineffizienzen im System erfasst werden. Wenn Patienten keinen Hausarzt finden und deshalb ins Spital gehen, wo die Behandlung teurer ist, so ist das eine dieser Ineffizienzen, die in diesem Bericht eingeschlossen ist. Das gleiche gilt für Ineffizienzen durch unnötige administrative Kosten, weil wir in der IT im Rückstand sind. Es gibt zahlreiche Faktoren, die durch die Leistungserbringenden nicht beeinflusst werden können.
Wie halten Sie denn von Smarter Medicine?
Eine Optimierung in Richtung Smarter Medicine verspricht ein Einsparpotenzial von 1 bis 1,5 Prozent. Daran arbeiten wir. Hier haben wir einen direkten Hebel.
Wenn man Ihnen so zuhört, Frau Gilli, erhält man den Eindruck, das Kostenwachstum im Gesundheitsweisen sei gar kein Problem.
Genau: Das Kostenwachstum ist kein Problem. Das heisst aber nicht, dass es keine Kostenverantwortung gibt. Es gibt Entwicklungen, die wir sinnvoll flankieren müssen. Dazu gehört die Prämienbelastung der Patienten und Patientinnen. Wenn zum Beispiel teure Operationen vermehrt ambulant statt stationär durchgeführt werden, so werden Prämienzahlende über Gebühr belastet, weil ambulante Eingriffe im Unterschied zu stationären Behandlungen voll von der Grundversicherung gedeckt sind. Wir brauchen ein Kostenbewusstsein, aber wir brauchen keine Kostenbremse-Initiative. Statt zu Kosteneinsparungen führt sie zur Zweiklassenmedizin. Privatversicherte und Selbstzahler werden diejenigen Behandlungen bekommen, welche über die Kostenbremse durch die Grundversicherung nicht mehr gedeckt sind.