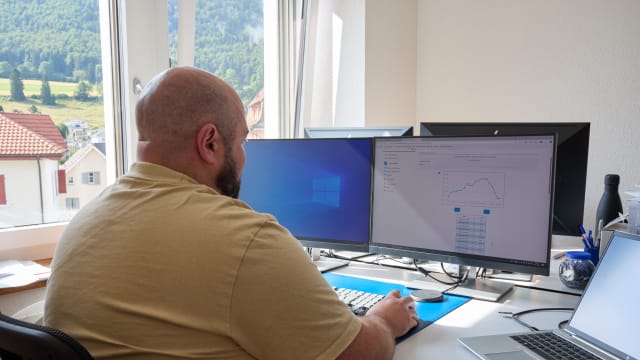Noch prägen kleine, selbständige Regionalspitäler mit 5'000 und weniger stationären Patienten pro Jahr die Spitallandschaft der Schweiz: Rund 36 Prozent der 101 Akutspitäler haben im Jahr 2023 zu ihnen gezählt. Doch sie stehen besonders unter Druck und suchen neue Modelle für die regionale Gesundheitsversorgung. Denn die Herausforderungen für sie wachsen in einer Branche, in der Grösse immer mehr zu einem wirtschaftlichen und qualitativen Vorteil wird.
Leo Boos ist seit 2008 Partner von H Focus. In dieser Zeit hat er zahlreiche Strategieprojekte in Spitälern begleitet und deren Umsetzung unterstützt. Vor 2008 hat er während sechs Jahren das Spital Limmattal als Direktor geleitet.
Stephan Pahls ist Inhaber & Managing Director von Pahls Management & Consulting mit Sitz in der Region Zürich. Seit April 2022 berät er Unternehmen und Organisationen in strategischen und operativen Fragen. Zudem ist er Vizepräsident der Spital Lachen AG.
Kleinere Spitäler oft finanziell überfordert
Der Trend der Medizin zur Spezialisierung erfordert grössere Einzugsregionen, um die spezialisierten Fachkräfte auszulasten. Bevor digitale Instrumente die Qualität der Diagnostik und die administrative Produktivität erhöhen, sind umfassende Investitionen gefordert, die kleine Häuser rasch finanziell überfordern.
Zudem fallen steigende Regulierungskosten unabhängig von der Spitalgrösse an. Gleichzeitig schrumpft die bisher tragende wirtschaftliche Basis der stationären Aufenthalte durch mehr ambulante Behandlungen inner- und ausserhalb der Spitalmauern. Das führt zu Ertragsausfällen und nicht gedeckten Kosten.
«Um das ganze Potenzial solcher Zusammenschlüsse zu nutzen, müssen Regionalspitäler auch ihre interne ärztliche Organisation anpassen.»
Spitalgruppen, die wie in den Kantonen Luzern, Ob- und Nidwalden Zentrums- und Regionalspitäler unter einem Dach vereinen, sind ein wichtiges Mittel, um die Rahmenbedingungen gerade für kleinere Häuser zu verbessern.
Die regionale Bevölkerung erhält einfacheren Zugang zu medizinischem Spezialwissen. Dank Telemedizin steigt die Qualität der Diagnostik vor Ort. Arbeitsplätze in der Region bleiben erhalten. Bei patientenfernen Tätigkeiten können Grössenvorteile realisiert werden.
Abschied vom «Zentrumsspital im Taschenformat»
Um das ganze Potenzial solcher Zusammenschlüsse zu nutzen, müssen Regionalspitäler auch ihre interne ärztliche Organisation anpassen. Die bisher dominierende Organisation von Regionalspitälern als «Zentrumsspital im Taschenformat» mit bettenführenden Kliniken entspricht weder dem Leistungsauftrag der medizinischen Grundversorgung noch den Anforderungen der zunehmend multimorbiden Patienten und den wirtschaftlichen Gesetzmässigkeiten.
Rund 70 Prozent der stationären Kosten fallen in Spitälern unabhängig vom Patientenaufkommen an. Wegen dieser Vorhaltekosten sind Spitäler mit grösserem Volumen besser in der Lage, finanziell erfolgreich zu arbeiten. In der Schweiz hat sich gezeigt, dass sich die Spitalorganisation» mit bettenführenden Kliniken erst ab einer stationären Fallzahl von rund 10'000 pro Jahr rechnet.
Die Klinikstrukturen mit parallelen Diensten auf den verschiedenen ärztlichen Hierarchiestufen sind bei geringerer Fallzahl weder aus Gründen der Qualität und Sicherheit der Patientenversorgung notwendig noch wirtschaftlich leistbar.
«Hospitalistenmodell»: Weitentwicklung der ärztlichen Organisation
Den Kern der neuen ärztlichen Organisation bildet die Innere Medizin. Denn die Internistinnen und Internisten sind die Fachspezialisten für «das Allgemeine» und damit prädestiniert für Behandlung und umfassende Betreuung von medizinisch immer anspruchsvolleren Patienten.
Sie sind als Hospitalistinnen und Hospitalisten fallführend verantwortlich für alle stationären Patientinnen und Patienten eines Regionalspitals.
Zusammen mit Anästhesie und Intensivmedizin leisten sie die «ärztliche Grundversorgung im Spital» inkl. Notfallmedizin. Zudem sorgen sie für die internistische Weiterbildung. Die chirurgischen und internistischen Spezialärztinnen und -ärzte sind für die spezialisierte Diagnostik, Interventionen und Therapien zuständig. Sie betreuen die Patientinnen und Patienten auf den interdisziplinären Bettenstationen mir ihrer Fachexpertise mit.
«In der Schweiz hat sich gezeigt, dass sich die Spitalorganisation» mit bettenführenden Kliniken erst ab einer stationären Fallzahl von rund 10'000 pro Jahr rechnet.»
Die Fallführung auf den Bettenstationen obliegt jedoch den Hospitalistinnen und Hospitalisten, die sich ausschliesslich um den stationären Bereich kümmern, während die spezialisierten ärztlichen Fachpersonen Behandlungen (Sprechstunden, Untersuchungen, Interventionen, Operationen) von ambulanten und stationären Patientinnen und Patienten durchführen.
Dieser Ansatz ist eine Weiterentwicklung des Hospitalistenmodells, das in den USA, Kanada und Australien weit verbreitet ist.
Dank Arbeitsteilung und klarem Fokus zeigt sich bei der praktischen Umsetzung solcher Modelle, dass auch ambulante Leistungen kostendeckend erbracht werden können. Mit der Zustimmung zur Integration des Kantonsspital Obwalden in die LUKS-Gruppe hat die Obwaldner Stimmbevölkerung einen zukunftsweisenden Entscheid für ihre regionale Gesundheitsversorgung gefällt, der hoffentlich Signalwirkung über die Innerschweiz hinaus entfaltet. Neben den bestehenden gesamtschweizerischen privaten Spitalgruppen könnten sich auch öffentliche Häuser neue Handlungsspielräume schaffen und durch die Bildung interkantonaler Spitalgruppen ihre Leistungen bedarfsgerecht abstimmen.
Neben Grössenvorteilen bietet sich kleineren Spitälern in Spitalgruppen die Chance, ihre Organisation besser auf die Bedürfnisse der heutigen Patientinnen und Patienten auszurichten. Das wäre ein wichtiger Schritt, um die Spitalversorgung auch in der Peripherie zu sichern.