
Ein Oensinger Gesundheitszentrum betreibt den ersten «Medicomat» in der Schweiz
Das Gerät im Vitasphère-Gesundheitszentrum funktioniert wie ein Getränkeautomat. Doch statt Flaschen gibt der Automat rund um die Uhr Medikamente heraus.

Loading

Das Gerät im Vitasphère-Gesundheitszentrum funktioniert wie ein Getränkeautomat. Doch statt Flaschen gibt der Automat rund um die Uhr Medikamente heraus.
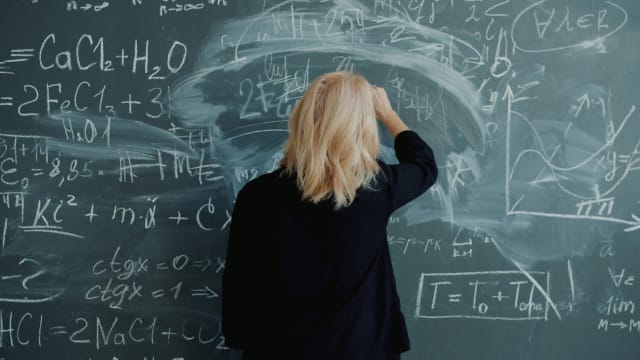
Laborwerte, Risiken, Therapieeffekte – viele Aufklärungsgespräche scheitern an medizinischen Zahlen. Doch wie erläutert man, was eine Behandlung bringt? Ein Vorschlag.

Getrennte Apotheken in Gruppenpraxen, Impfverbote in der Pflege, teure Zusatzkontrollen: Groteske Behörden- und Kassenentscheide lähmen die Versorgung. Sind wir Ärzte eigentlich Komiker?

Der ärztliche Beruf verändert sich – und mit ihm die Erwartungen. Viele Ärztinnen und Ärzte suchen heute mehr als nur eine Anstellung: Sie suchen Wirksamkeit, Gestaltungsspielraum und ein Umfeld, das ihre Werte teilt.
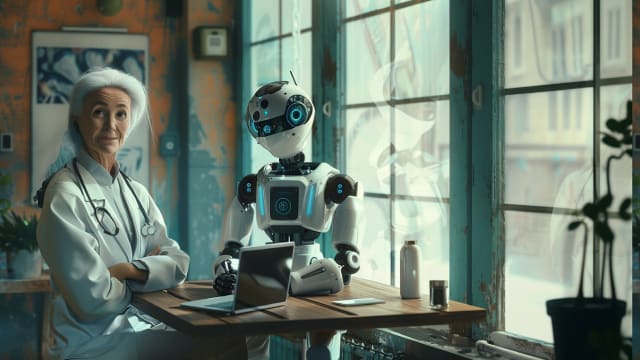
Die meisten Menschen können sich vorstellen, medizinischen Rat bei einem Chatbot zu holen. Und eine klare Mehrheit findet, dass die Ärzte KI-Unterstützung haben sollten. Dies besagt eine Erhebung in Deutschland.

Eine Metastudie ging der Frage nach, welche medizinischen Fachleute die nachhaltigste Verbesserung bei Hypertonie-Patienten erreichen.

Bei einer Patientin traten nach einer Darmspiegelung unerwartet schwere Komplikationen auf. Das Bundesgericht stellt nun klar: Die Ärztin aus dem Kanton Aargau kann sich auf die «hypothetische Einwilligung» der Patientin berufen.

Neue Studie aus den USA wirft Fragen auf: Wettbewerb allein garantiert keine besseren Operationsergebnisse.

Während der Ausbildung nimmt das Einfühlungsvermögen von angehenden Ärztinnen und Ärzten tendenziell ab: Das besagt eine neue Studie.