
«Sich blindlings auf KI zu verlassen, kann verheerende Folgen haben»
KI-Kameras im Universitätsspital Zürich sorgen für Diskussionen über Datenschutz und Patientensicherheit. IT-Experte Marc Ruef erklärt Chancen und Risiken. Das Interview Teil 2
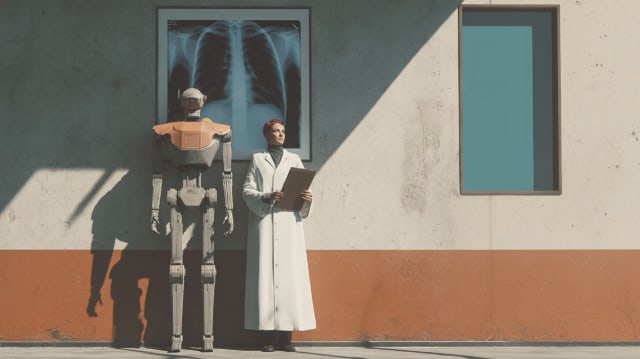
«Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI-Modellen ein grosses Potenzial zur Verbesserung der Patientensicherheit hat.» Nikolas Zöller, Erstautor, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
Loading

KI-Kameras im Universitätsspital Zürich sorgen für Diskussionen über Datenschutz und Patientensicherheit. IT-Experte Marc Ruef erklärt Chancen und Risiken. Das Interview Teil 2

Epic verspricht Standardisierung, Effizienz und hohe Sicherheitsstandards. Doch je zentraler und mächtiger ein Klinik-Informationssystem ist, desto attraktiver wird es für Angreifer, sagt IT-Experte Marc Ruef im Interview Teil 1.

Als erste Institution in der Schweiz nutzt die Klinik Hirslanden das Operationssystem «Da Vinci 5». Zunächst kommt es in der Viszeralchirurgie und Urologie zum Einsatz.

Mit einem Deep-Learning-Modell wurde erstmals ein Biomarker für chronischen Stress in der Bildgebung entdeckt: Der «Adrenal Volume Index» deckt sich mit Cortisolspiegel, subjektiv wahrgenommenem Stress – und sogar mit dem Risiko für Herzinsuffizienz.
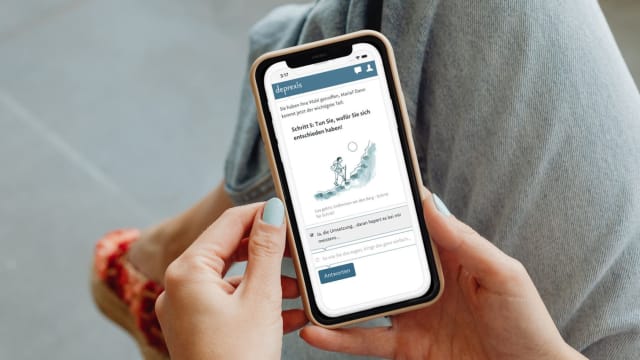
Die Schweiz führt ab Sommer 2026 Kostenübernahmen für digitale Therapien ein. Nun wurde eine erste Anwendung für die MiGel-Liste der Grundversicherung bewilligt.

Weil der Regierungsrat zu Kosten und Risiken kaum Transparenz zeigt, verlangen mehrere Parteien jetzt eine parlamentarische Untersuchung.

Statt nur das Bakterienwachstum zu beurteilen, analysiert ein neu entwickelter Test aus Basel, ob Antibiotika einzelne Erreger tatsächlich abtöten – und wenn ja, wie schnell. Die Methode könnte helfen, Therapieerfolge realistischer einzuschätzen.

Bei vielen Menschen mit Retinitis pigmentosa war die genetische Ursache bislang unklar. Eine internationale Studie unter Basler Leitung zeigt nun, dass Varianten in fünf RNA-Genen die Erkrankung auslösen können. Dies eröffnet neue Wege für Diagnostik und Therapie.

Die US-Arzneimittelbehörde hat zwei neue orale Antibiotika zur Behandlung von Tripper zugelassen. Besonders Zoliflodacin gilt als Hoffnungsträger im Kampf gegen resistente Gonokokken. In der Schweiz steigen derweil die Fallzahlen.