
Was unsere Fingernägel über unsere Ernährung verraten
Eine Studie der Hochschule Fulda zeigt erstmals im Detail, wie zuverlässig Mineralstoffmuster in Nägeln den Ernährungsstil abbilden können.
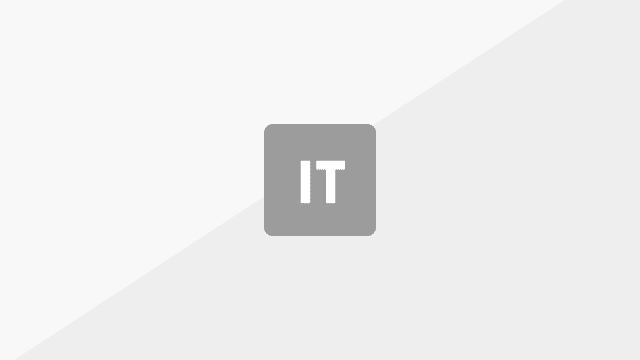
Loading

Eine Studie der Hochschule Fulda zeigt erstmals im Detail, wie zuverlässig Mineralstoffmuster in Nägeln den Ernährungsstil abbilden können.

Besonders in Onkologie, Immunologie und Pharmakologie finden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Schweiz weltweit Beachtung.

Ab sofort können Patienten am linken Zürichseeufer über das See-Spital Horgen, die Hospital at Home AG und die Spitex Horgen-Oberrieden zu Hause statt im Spital behandelt werden.

ETH-Forschende haben einen magnetisch steuerbaren Mikroroboter entwickelt, der auch in komplexe Gefässstrukturen vordringt. Das System bringt Medikamente präzise an den Zielort – und löst sich danach auf.

Das US-Magazin «Time» kürte die wichtigsten Innovationen des Jahres aus dem Gesundheitswesen. Die Auswahl zeigt: Fortschritt in der Medizin bedeutet heute vor allem neue Schnittstellen zwischen Mensch, Maschine und Methode.

Andreas Moor (ETH Zürich) und Inmaculada Martínez Reyes (DKFZ/Charité Berlin) erhalten je 250’000 Franken für ihre Arbeiten an zielgerichteten Krebstherapien – von «smarten» Proteinmolekülen bis zu personalisierten Immunzellen.

Bei einer Patientin traten nach einer Darmspiegelung unerwartet schwere Komplikationen auf. Das Bundesgericht stellt nun klar: Die Ärztin aus dem Kanton Aargau kann sich auf die «hypothetische Einwilligung» der Patientin berufen.

Neue Studie aus den USA wirft Fragen auf: Wettbewerb allein garantiert keine besseren Operationsergebnisse.

Während der Ausbildung nimmt das Einfühlungsvermögen von angehenden Ärztinnen und Ärzten tendenziell ab: Das besagt eine neue Studie.