
Neue Allianz für mentale Gesundheit
Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) und der Krankenversicherer CSS lancieren gemeinsam ein neues Angebot im Bereich der integrierten Versorgung.
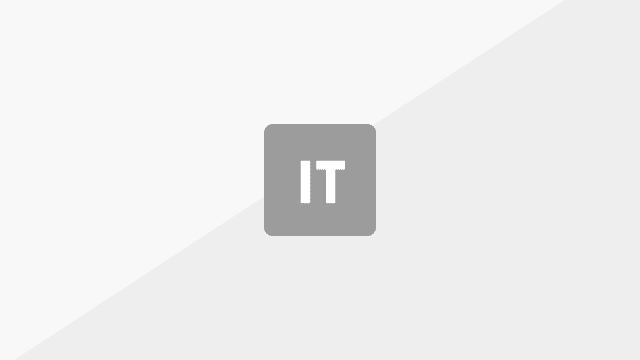
Loading

Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) und der Krankenversicherer CSS lancieren gemeinsam ein neues Angebot im Bereich der integrierten Versorgung.

Mit Caroline Pot und Silke Biethahn führt erstmals ein weibliches Duo die Schweizerische Neurologische Gesellschaft.

Besonders in Onkologie, Immunologie und Pharmakologie finden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Schweiz weltweit Beachtung.

Die Fusion der Stiftung Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste St.Gallen und der Klinik Sonnenhof erfolgt nicht aus Spargründen, sondern um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

Markus Gschwind, Leitender Arzt am Kantonsspital Aarau, wurde zum Präsidenten der grössten neurologischen Fachgesellschaft des Landes gewählt.

ETH-Forschende haben einen magnetisch steuerbaren Mikroroboter entwickelt, der auch in komplexe Gefässstrukturen vordringt. Das System bringt Medikamente präzise an den Zielort – und löst sich danach auf.

Wir vergleichen das Kispi Zürich mit dem Opernhaus Zürich. Geht das? Durchaus. Denn beide haben dieselbe Aufgabe: zu funktionieren, wo Wirtschaftlichkeit an Grenzen stösst.

Das Bundesgericht greift in die WZW-Ermittlungsverfahren ein: Ein Grundsatzurteil dürfte die gängigen Prozesse umkrempeln.

Palliative Care löst nicht alle Probleme im Gesundheitswesen: … Palliative Care kann jedoch ein Hebel sein.