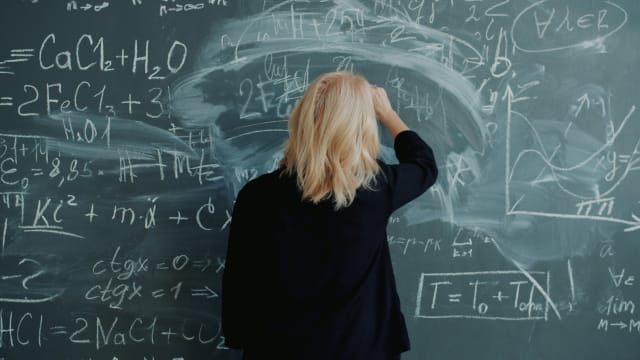In der «Neuen Zürcher Zeitung» haben Leander Muheim vom Zürcher Institut für Hausarztmedizin und Felix Huber, ärztliche Leitung Medix Zürich, einen Text publiziert, dem eine gewisse Einseitigkeit der Sichtweise anhaftet:
«Hausarztmodelle als Erfolgsgeschichte».
Die Autoren loben die «Kostenmitverantwortung» ihrer Modelle als Konstrukt, das dem Arzt finanziellen Anreiz biete, «genau so viel zu tun, wie es der Zustand und die Bedürfnisse des Patienten erfordern».
Flavian Kurth
ist Sekretär und stv. Projektleiter beim Verein Ethik und Medizin Schweiz in Olten. Der VEMS versteht sich als von sämtlichen Akteuren des Gesundheitswesens unabhängige wissenschaftliche Organisation, die insbesondere mit statistischer Kompetenz zur Debatte beitragen will.
Wie wird dies nun aber sichergestellt? Zwischen Netzwerk und Kasse gibt es Verträge, über die Köpfe der Versicherten und Patienten hinweg und ohne deren Kenntnis; diese Verträge legen das Budget fest – aber auch Strafen bei Überschreitung sowie Boni bei Unterschreitung.
In deutschen Netzwerken sind solche Verträge verboten, und das aus gutem Grund. Da die so vereinbarten Budgets im Voraus und ohne Kenntnis der konkreten Patientensituation beschlossen werden, kann auch nicht die Rede davon sein, dass der Anreiz besteht, «genau so viel zu tun, wie es der Zustand und die Bedürfnisse des Patienten erfordern». Denn jener Zustand und jene Bedürfnisse sind zum Zeitpunkt der Vereinbarung ja noch gar nicht bekannt.
Wird Unterversorgung belohnt?
Vielmehr ist es so, dass der Arzt angehalten ist, genau so viel zu tun, wie der Zustand des festgelegten Budgets erlaubt. Gelingt ihm dies nicht, wird er gebüsst, gelingt es ihm besonders gut, winkt ein Bonus.
Könnte es also sein, dass der Arzt hier für die Unterversorgung seines Patienten belohnt wird? Muheim und Huber winken ab: «Eine Unterversorgung ist mit einem Vertrauensverlust der Patienten und hohen Krankheits- und Notfallkosten verbunden».
Gut. Was tut ein Patient und Versicherter nun aber, wenn er das Vertrauen in ein Modell verliert? Genau: Er wechselt es – falls ihm sein Haushaltsbudget dies überhaupt erlaubt.
Nehmen wir an, das sei der Fall: Was passiert nun? Seine Gesundheitskosten werden wohl sprunghaft ansteigen, denn nun holt er im neuen Modell die überfällige medizinische Versorgung nach – zu den Kosten einer verteuerten, weil verspäteten Behandlung. Der Managed-Care-Versicherer weiss davon nichts, denn mit Verlassen des Modells erscheint der kritische Patient auch nicht mehr auf seinem Radar.
Tun die Versicherer das?
Folglich wäre es – wir sind bei der Begleitforschung – doch im ureigensten Interesse der Versicherer, herauszufinden, was mit jenen Personen passiert, die das Modell verlassen. Das sind die interessanten Fälle; sie weiterzuverfolgen ist die Grundlage einer Verbesserung des Angebots.
Dazu aber müssten die Versicherer ihre Daten zusammenlegen, und dies ist angeblich nicht möglich, selbst anonymisiert nicht. Bleibt die Lösung, die andere Firmen in anderen Märkten wählen: Man befragt die Austretenden über ihre Gründe. Aber tun die Versicherer das?
Das muss bezweifelt werden, denn daraus würde ja eine Verfeinerung des Angebots resultieren, was wir gerade nicht beobachten. Vielmehr wird gebetsmühlenartig wiederholt, diese Modelle würden Kosten sparen und die Qualität dabei sogar verbessern – ohne Spezifizierung, für welche Patienten und für welche nicht.
Man nennt es Echokammer
Kein Angebot passt einfach für alle. Es ist unglaubwürdig, wenn die MC-Anbieter dies nach Jahren, in denen sie Erfahrungen hätten sammeln können, noch immer platt behaupten. Sie sind angehalten, nun endlich Zahlen vorzulegen, in welchen Fällen sich das Modell rechnet – und wo nicht.
Die Begleitforschung der CSS stellt denn auch fest, dass Austretende oftmals sehr niedrige Gesundheitskosten haben. Sie schliesst daraus dann aber, diese hätten wohl in ein noch günstigeres Modell gewechselt. Mit anderen Worten: Was nicht sein darf – eine Unterversorgung im Netz –, das kann auch nicht sein. Man nennt das Echokammer.
Fassen wir zusammen: Wir haben ein Modell, das mit Verträgen im rechtlichen Graubereich arbeitet. Und dabei werden die Gefahren, die sich aus der Budgetverantwortung ergeben, nicht untersucht, sondern als inexistent erklärt. Die Begleitforschung dazu ist ein Arm der Marketingabteilung.
Doch die Prämienlast zwingt Versicherte mit kleinem bis durchschnittlichem Einkommen, sich in solchen Modellen zu versichern.
Zufriedene Kunden sehen anders aus. Hausarztmodelle nun aber als «Schweizer Erfolgsgeschichte» zu verkaufen, ist nachgerade zynisch. Und das wirklich Traurige daran ist: Sie könnten es vielleicht sogar sein, würden sich die Versicherer endlich Evidenzgrundlagen dazu erarbeiten und darauf basierend ihre Angebote weiterentwickeln, anstatt nur immer wieder dieselben Verkaufsphrasen zu predigen.