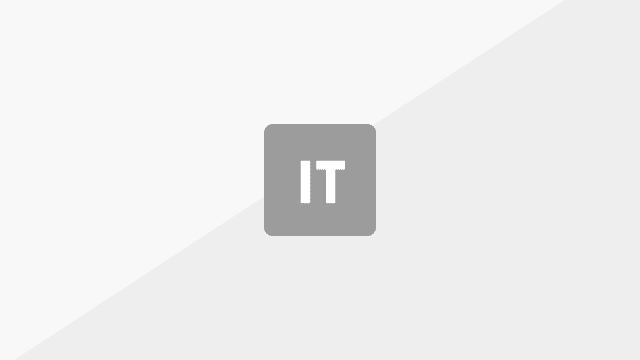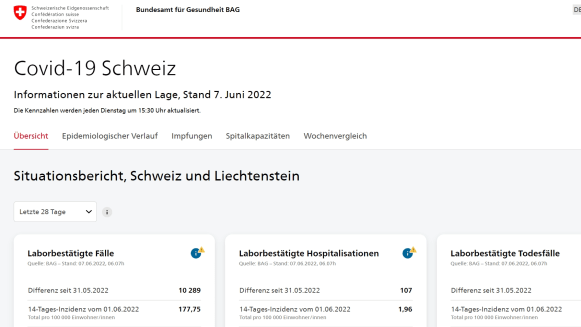Meinten die Schöpfer des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) noch, das Kostenwachstum im Gesundheitswesen mit Preiswettbewerb begrenzen zu können, so stehen heute eher staatliche beziehungsweise planerische Massnahmen dazu zur Diskussion. So möchte eine von Bundesrat Alain Berset eingesetzte Arbeitsgruppe aktuell Zielvorgaben für das OKPWachstum via Globalbudget setzen.
Die Kosten des Gesundheitswesens, die wir mit den Versicherungsprämien finanzieren, sind die Folge von zwei Komponenten, nämlich Menge und Preis. Menge ist die Zahl der durchgeführten medizinischen Behandlungen und Preis ist die Abgeltung der Behandlung. Wachsen die Komponenten, Preis und/oder Menge, steigen die Kosten im Gesundheitswesen.
Die Menge, also die Zahl der Behandlungen, ist in der Schweiz nicht vorgegeben. Hingegen ist der Preis vorgegeben und wird von den Tarifpartnern vertraglich festgesetzt, so zum Beispiel der Taxpunktwert im Tarmed oder die Baserate im DRG-System.
Da offenbar der Preiswettbewerb nicht zum Erfolg geführt hat, darf der Mengenpla-nung durchaus eine Chance gegeben werden. Es muss ja nicht gleich ein umfassendes Globalbudget eingeführt und das heute geltende System vollständig umgekrempelt werden. Degressive Abgeltungen auf der Grundlage der heutigen Tarife bei Überschreiten von Zielvorgaben würden eine ähnliche Wirkung erzielen. Degressive Tarife könnten die Tarifpartner im übrigen auch heute schon ohne zusätzliche gesetzliche Regelungen einführen.
Wichtig ist, dass für die Mengenbegrenzung nicht zusätzlicher administrativer Aufwand notwendig wird, sondern im Gegenteil, die Chance genützt wird, die heutige Bürokratie im Sinne von höherer Effizienz abzubauen.
Dies betrifft in erster Linie die aufwändigen Spitalplanungen der Kantone. Unter dem Stichwort «Qualitätssicherung» sind eigentliche Bürokratiemonster im Entstehen. Nicht nur, dass auf der Grundlage von Prozeduren- und Diagnosecodes flächendeckend kontrolliert wird, ob jedes Spital seinen Leistungsauftrag auch tatsächlich einhält. Nein, es soll auch noch auf Stufe Arzt ein Controlling für die Sicherstellung einer Mindestzahl operativer Eingriffe eingeführt werden.
Aber auch die Versicherer haben für die Leistungskontrolle Bürokratiemonster ein-geführt. So werden beispielsweise immer öfter die Codierungen für die DRG Rechnungstellung im Einzelfall von den Versicherern nachgerechnet, um so sicherzustellen, dass wirklich die richtige DRG-Pauschale fakturiert wird.
Bei einem erfolgreichen Begrenzen des OKP-Wachstums sind die teuren Spitalplanungen zu reduzieren auf die Sicherstellung eine Minimalplanung im Kanton, so wie es auch der Auftrag des KVG’s wäre. Wenn das Wachstum begrenzt wird, braucht es die aktuellen, umfassenden Spitalplanungen schlicht nicht mehr.
Das Gleiche gilt auch für die Krankenversicherer beziehungsweise für die Rechnungskontrolle. Ein Blick nach Deutschland, wo für die Versicherer gemeinsame medizinische Dienste die Rechnungskontrolle vollziehen, würde sich aus Effizienzgründen lohnen. Noch effizienter und kostengünstiger wäre die Einführung gemeinsamer Trustcenter der Spitäler und Versicherer für die korrekte Abwicklung der DRG-Rechnungstellung.
Das sind zwei der wichtigsten Stossrichtungen, mit denen via Abbau unnötig werdender Bürokratie das Gesundheitswesen kostenmässig entlastet werden könnte.
Zum Verfasser
Peter Fischer, vor ziemlich genau 61 Jahren geboren, ist in Brunnen im Kanton Schwyz aufgewachsen, wo er die Matura machte. Er studierte Jura in Fribourg und absolvierte ein Executive MBA in Zürich. Von 1997 bis 2005 war Fischer stellvertretender Vorsitzender der Helsana und von 2005 bis 2012 CEO der Visana-Krankenkasse. Anschliessend wechselte Fischer die Seite und wurde Verwaltungsratspräsident der Lindenhof-Spitalgruppe in Bern und bis Ende Juli 2017 Direktor im Privatspital Hohmad in Thun. Heute sitzt das FDP-Mitglied in Stiftungs- und Verwaltungsräten und leitet als Gemeinderat von Hilterfingen das Ressort Finanzen.